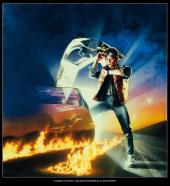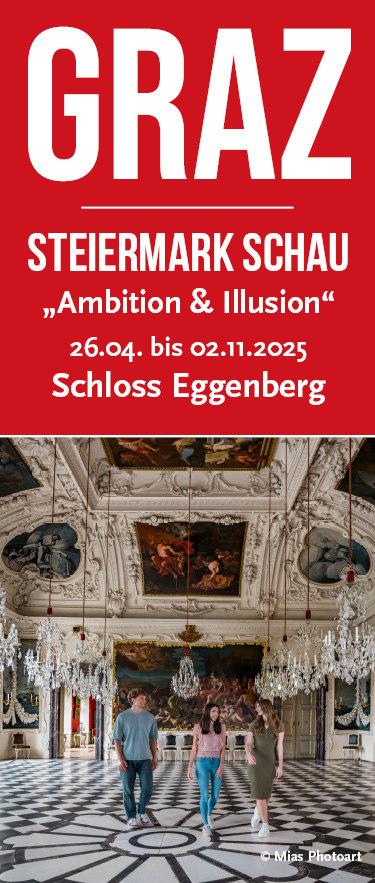Tickets und Infos neuebuehnevillach ALIENce
Nathan der Weise
Der reiche Jude Nathan, genannt »der Weise«, ist gerade in seine Heimatstadt Jerusalem zurückgekehrt und erfährt, dass seine Tochter Recha von einem christlichen Tempelherrn vor dem Feuertod gerettet worden ist und dass ihn der Sultan Saladin sprechen möchte. Der Sultan, der Geldsorgen hat, gibt vor, Nathans bekannte Weisheit zu testen und fragt nach der »wahren Religion«. Nathan antwortet mit der berühmten Ringparabel. Saladin versteht schnell die Botschaft von der Gleichberechtigung der drei monotheistischen Religionen und zeigt sich tief beeindruckt von Nathans Klarsicht und Großzügigkeit. Als sich der Tempelherr unterdessen in Recha verliebt und ihre wahre Herkunft ans Licht kommt, wird die Lehre der Parabel – Humanität und Toleranz gegenüber anderen Religionen – noch einmal verdeutlicht.
Veranstaltungsvorschau: Nathan der Weise - Next Liberty - Theater für junges Publikum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Pirates of Musical
Die 7 Meere des Show Business werden von ein paar mächtigen Lobbyisten, habgierigen Produzenten, geldgierigen Intendanten und Medienbossen beherrscht. Alles dreht sich um das Geld und niemanden kümmert die Kunst.
Nur was vermarktbar ist wird von den Produzenten auf die Bühnen gebracht. Sie erwerben frühzeitig Rechte von Musicals, die dann nach ihrer Manipulation das Showlicht der Bühnen erblicken, oder auf ewige Zeit im Tresor landen. Sie agieren wie mächtige Showboats, die durch die Weltmeere cruisen und die Menschen mit ihren irrwitzigen, inhaltlosen und geldverschlingenden Megaproduktionen die Gehirnwindungen zudröhnen.
Nur eine kleine Gruppe rund um den jungen Robin Rock - genannt die Piraten des Musicals - lehnt sich gegen das mächtige Showimperium auf. Sie segeln auf ihrem Schiff, der "Killer Queen", durch die Weltmeere des Musicals. Dabei entern sie immer wieder die Showboats der Mächtigen und holen sich die Rechte der Musicals, die nie gespielt wurden, oder nur in zensurierter Fassung den Weg auf die Bühnen fanden, zurück.
So befreien Robin Rock und seine Mannschaft immer öfters neue Musicals und bringen sie als Shows illegal unter das Volk. Die Anhängerschaft des wahren Musicals wächst und wächst, und somit auch der Hass und Unmut der Produzenten auf die Freibeuter.
Veranstaltungsvorschau: Pirates of Musical - Theater Akzent
Keine aktuellen Termine vorhanden!My Secret / My Fear
Bin ich bereit, mich zu meinen geheimen Wünschen zu bekennen, mit ihnen nach außen zu gehen? Bin ich bereit, mich der Angst zu stellen und so, Schritt für Schritt, einen neuen Weg zu gehen, mir eine unbekannte Freiheit zu erobern, die meinen Umgang mit mir und den anderen verändert?
Verbirgt man etwas, damit es einem ganz allein gehört? Soll ein Geheimnis wirklich geheim bleiben? Oder will man, dass es entdeckt, gesehen, ernst genommen wird? Was ist stärker? Die Lust auf ein „Geheimnis“? Die Angst vor der Bloßstellung? Wie groß ist die Angst vor den anderen, vor sich selbst, wenn man „heimliche Seiten“ offenbart? Eine Gruppe junger Leute trifft bei einem Event zusammen. Manche kennen sich, einige lernen sich erst kennen. Langsam erfährt jeder ein bisschen mehr vom Gegenüber. Aber wieviel wissen sie wirklich voneinander?
So unterschiedlich sie sind, eines haben sie gemeinsam: ihre persönlichen Geheimnisse, Wünsche, Ängste und Träume … Auf der Bühne stehen 14 Jugendliche.
Unter der künstlerischen Leitung von Karin Steinbrugger entwickelt homunculus seit 2003 regelmäßig Tanztheater für junges Publikum. Auf inhaltlicher Ebene bestimmen die künstlerische Bearbeitung von Konfliktthemen und gesellschaftspolitische Anliegen die Wahl der Themen. Junges Publikum soll Theater als Ort aktiver und kritischer Auseinandersetzung mit Themen unserer Zeit und unserer Gesellschaft erleben.
KONZEPT/ CHOREOGRAFIE: Karin Steinbrugger, Martina Haager / NACH: einer Idee von Heinz Janisch / LICHTDESIGN: Silvia Auer / MUSIK: Martin Kratochwil / PRODUKTION: Sonja Haupt, Nikolaus Selimov / TÄNZERINNEN: Leonie Bruckner, Benjamin Brugat, Gina Christof, Ben Feigl, Gregor Kadziolka, Mira Kapfinger, Bernadette Kizik, Anna Lisa Kopeinig, Ursula Leitner, Julia Polt, Sebastian Radon, Silvana Veit
Veranstaltungsvorschau: My Secret / My Fear - Dschungel Wien - Theaterhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Crash - der ganz andere Deutschunterricht
Die riskante Fahrt startet im 12. Jahrhundert mit dem verwegenen Piloten Walther von der Vogelweide. Dann geht's mit Lichtgeschwindigkeit ins 21. Jahrhundert. Zwischenstopps bei Abraham a Sancta Clara, Franz Grillparzer, Johann Nepomuk Nestroy, Arthur Schnitzler, Robert Musil, Franz Kafka, Ingeborg Bachmann, Werner Schwab, Christine Nöstlinger usw. sind vorgesehen. Landeziel: Elfriede Jelineks Wohnzimmer.
Veranstaltungsvorschau: Crash - der ganz andere Deutschunterricht - Dschungel Wien - Theaterhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Tandaradei: Hier geht's uns gut
„Und was machst du jetzt so?“ Christian hat gerade seine Matura bestanden. Die große Freiheit lockt in alle Richtungen und die Türen stehen nun endlich offen. Ferien machen, Spaß haben, Nächte durchfeiern!! Und dann …? Arbeiten – Studieren – ins Ausland gehen? Jede/r scheint schon einen Plan zu haben. Jede/r hat „es“ gefunden. Die Stimmen um ihn werden immer lauter: „Du musst dich jetzt endlich entscheiden!“
Das Stück erzählt auf witzige und skurrile Weise eine Lebensphase, in der sich Änderungen anbahnen und neue Wege eingeschlagen werden.
Veranstaltungsvorschau: Tandaradei: Hier geht's uns gut - Dschungel Wien - Theaterhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Hubertus Zorell: Faust
Sex and crime, das interessiert die Leute, sonst nichts! Dass man ein Leben lang werkt und schafft und gestaltet, ist offenbar total unwichtig. Immer wird nur nach derselben Geschichte gefragt: Gretchen, Gretchen, Gretchen!
Dabei war der ganze Skandal nichts als eine Verkettung unglücklicher Umstände. Die Sache mit der Überdosis für die kränkliche Mutter. Der Notwehrakt gegen diesen militanten Bruder in seiner Ehrenmord-Hysterie. Und mit der Kindstötung hatte ich persönlich gar nichts zu tun! Ich, Faust, war nicht einmal in der Nähe! Was kann ich dafür, wenn das Mädchen plötzlich durchdreht?! Im Endeffekt habe ich mir da überhaupt nichts vorzuwerfen. Ist doch so! Oder?
Veranstaltungsvorschau: Hubertus Zorell: Faust - Dschungel Wien - Theaterhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!TheaterFOXFIRE & DSCHUNGEL WIEN: darksite
Ilai und Max Berger leben mit ihrer Freundin Didi zusammen in der Wohnung der meist abwesenden Eltern. Kontakt haben sie zu ihren Eltern nur per Telefon oder Videositzungen. Nur selten verlassen sie die Wohnung und suchen stattdessen nach echten Gefühlen im Internet. Sie bereiten eine Website zum Thema Angst vor. Material dafür sind Filmaufnahmen von Menschen, die sie in ihre Wohnung locken, um ihnen dort Angst einzujagen. Immer mehr verstricken sie sich in Internet, Drogen und erfundene Identitäten.
Gefährlich wird es, wo sich virtuelle Welt, Realität und verdrängte Erinnerungen nahe kommen. Der Rückzug der drei Jugendlichen in ihre eigene Welt geschieht stillschweigend. Unbeobachtet verschwinden sie von der Bildfläche des alltäglichen Lebens. Sie halten sich in einem Dunkelbereich auf, in dem sie alle verlockenden und finsteren
Seiten entfalten können – sie sind wahre „Kinder der Nacht“.
Veranstaltungsvorschau: TheaterFOXFIRE & DSCHUNGEL WIEN: darksite - Dschungel Wien - Theaterhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Hubertus Zorell: Blumen, nass von Blut. Das Nibelungenlied
Auf den ersten Blick ist Heldentum etwas, das Männer unter sich ausmachen. Sie kämpfen gegeneinander und wer übrig bleibt, ist erwiesenermaßen der größere Held. Aber genau an diesem Punkt – wo die einen ins Gras beißen, und die anderen sich ihr Heldentum bestätigen – wirft das Nibelungenlied regelmäßig einen Seitenblick auf eine dritte Gruppe von Beteiligten: auf die Frauen der besiegten Helden. Sie weinen.
Helden sind also genau dadurch Helden, dass sie Frauen zum Weinen bringen.
Indem sie andere Helden besiegen, oder aber auch über den direkten Weg: indem sie die Frauen austricksen und betrügen, sie vergewaltigen, prügeln und berauben. Und die Liebe? Wird nicht auch aus Liebe gekämpft? Doch, doch, natürlich. Die Liebe gerät nur eben sehr leicht in Vergessenheit, wenn man so viel mit dem Heldentum zu tun hat.
Veranstaltungsvorschau: Hubertus Zorell: Blumen, nass von Blut. Das Nibelungenlied - Dschungel Wien - Theaterhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!NippleJesus
Roli Winkler, ein Wachdienstangestellter aus dem Burgenland, kündigt nach einem unschönen Zwischenfall seinen Job in einer Wiener Innenstadttiefgarage, und muss - um Frau und Kinder erhalten zu können - die nächstbeste Arbeit annehmen. So landet er unvermittelt zwischen älteren Herrschaften und StudentInnen als Aufseher im Museum. Durch eine etwas freizügige Auslegung seiner frühzeitig beendeten Polizeiausbildung erhält er aber auch dort einen Spezialauftrag: er bewacht exklusiv ein einzelnes Kunstwerk mit dem bezeichnenden Titel „NippleJesus“, die kontroversielle Arbeit einer jungen Künstlerin.
Im direkten Kontakt mit dem sehr explizit ausgeführten Heilandsbild und nach einer persönlichen Begegnung mit seiner Schöpferin, beginnt seine anfängliche Ablehnung einer etwas differenzierteren Sichtweise Platz zu machen.
Im Verlauf der ersten zwei Ausstellungstage begegnen ihm mit den BesucherInnen die unterschiedlichsten Haltungen gegen das Werk, und er beginnt sich mehr und mehr mit der ihm anvertrauten Arbeit zu identifizieren...
Veranstaltungsvorschau: NippleJesus - Dschungel Wien - Theaterhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!ALIENce
Die Schülerinnen und Schüler werden so weit wie möglich in den Schreib- wie auch in den Inszenierungsprozess eingebunden und lernen so auch Theater von innen kennen und arbeiten gleichzeitig ein Thema, das jeden einzelnen betrifft, intensiv auf. Spezifisch werden bei diesem Projekt vor allem Ausgrenzungsmechanismen in all ihrer Breite und ihren Folgen behandelt werden.











 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner