Tickets und Infos Theater Akzent Das Glas Wasser
Die Glut
In einem ungarischen Schloss im kriegserschütterten Europa der 1940er Jahre erwartet Henrik, ein General der k.u.k Armee im Ruhestand, die Ankunft Konrads.
Veranstaltungsvorschau: Die Glut - Theater in der Josefstadt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Endlich Schluss!
Ich hatte dramatische Krankheiten, doch keine raffte mich hinweg, keine löschte mich aus. Ich hustete wie Kafka und wartete auf den Blutsturz. Ich untersuchte meinen Körper nach den Knoten einer nietzscheanischen Geschlechtskrankheit, ich soff wie Hemingway, ich rauchte eine nach der anderen und hoffte, wie Puccini an Kehlkopfkrebs zu sterben.
Ich wollte wie Büchner vom Typhus hinweggeraft werden, ich wollte gebissen werden wie Ferdinand Raimund, oder zumindest wie Alban Berg an einem Insektenstich zugrunde gehen. (…) Ich beschloß, mich selbst zu töten.
Veranstaltungsvorschau: Endlich Schluss! - Vestibül
Keine aktuellen Termine vorhanden!SCHRÄGLAGE – WASSER BIS ZUM HALS
Wie zwei Schiffbrüchige ergreifen sie als moderne Don Quichotes slapstickhaft jeden Strohhalm, der sich zur vermeintlichen Rettung aus ihrer Situation bietet.
Veranstaltungsvorschau: SCHRÄGLAGE – WASSER BIS ZUM HALS - Theater Forum Schwechat
Keine aktuellen Termine vorhanden!Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
FRANZ WOYZECK
Oliver Welter, Bandleader von Naked Lunch (2007 ›Amadeus-Award – FM4 Alternative Act des Jahres‹), gibt der Produktion mit der Komposition der Bühnenmusik einen wesentlichen Akzent.
Regie: Alexander Kubelka
Bühne und Kostüme: Thomas Wörgötter
Titelrolle: Heinz Weixelbraun
Veranstaltungsvorschau: FRANZ WOYZECK - Vorarlberger Landestheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Liliom
Liliom ist Türsteher im Café Rennbahn der Frau Muskat - und ein Strizzi, roh, brutal, aber charmant. Alle Frauen liegen ihm zu Füßen. Auch die kleine Julie verliebt sich in ihn, sehr zum Missfallen der eifersüchtigen Muskat. Ein Streit eskaliert und endet mit der Entlassung Lilioms. Auch Julie verliert ihre Stelle.
Im braven Familienleben angekommen, findet sich Liliom nicht zurecht. Er liebt Julie und dennoch - er ist unfähig, seine Gefühle zu zeigen, und schlägt sie. Als sie schwanger wird, verschärft sich die Situation, denn er braucht dringend Geld. Ein Freund überredet ihn zu einem Raubüberfall. Das Verbrechen scheitert jedoch kläglich, sein Komplize entkommt, Liliom wird gestellt und bringt sich um, ehe er verhaftet werden kann.
Im Jenseits erhält Liliom eine zweite Chance, etwas Gutes für Julie und das gemeinsame Kind zu tun. Für einen Tag darf er zurück auf die Erde ...
Liliom wurde 1909 in Budapest wenig erfolgreich uraufgeführt. Erst in der Bearbeitung und Übersetzung von Alfred Polgar, der das Stück aus dem Budapester Stadtwäldchen in den Wiener Prater transferierte, begann 1913 dessen weltweiter Siegeszug. Liliom wurde mehrfach verfilmt (u.a. von Fritz Lang 1934) und diente Rodgers und Hammerstein als Vorlage für das Musical Carousel.
„Jeder hat schon einmal eine Schießbude im Stadtwäldchen gesehen. Erinnern Sie sich daran, wie kindisch, wie komisch alle Figuren darauf dargestellt sind? Der Jäger, der Trommler mit dem dicken Bauch, der Knödelschlucker, der Kavallerist. Arme, schlechte Schildermaler malen diese Figuren so, wie sie sich das Leben vorstellen. Ich wollte das Stück auch in solcher Weise schreiben. Mit den Gedankengängen eines armen Schaukelgesellen im Stadtwäldchen, mit seiner Fantasie und seiner Ungehobeltheit." (Franz Molnár)
Veranstaltungsvorschau: Liliom - Volkstheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Penthesilea – Traum ohne Flügel
Koproduktion Ariadne-Theater und KosmosTheater
Bearbeitung von Evelyn Fuchs
Regie: Evelyn Fuchs
Szenographie/Kostüme: Andreas Hutter
Sound: Wolfgang Reisinger
Veranstaltungsvorschau: Penthesilea – Traum ohne Flügel - Kosmos Theater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Höllischer Himmel - eine Revue!
Uraufführung | Eigenproduktion
Idee/Konzept/Regie: Susanne Draxler
Buch: Michaela Riedl-Schlosser
Komposition/Songtexte: Herbert Tampier
Ausstattung: Sam Madwar
Lichtdesign: Albert Haderer
Musik: Barbara Ruppnig, Herbert Tampier
Mit: Claudia Kottal, Heidelinde Pfaffenbichler, Linde Prelog, Susanne Rader
Was passiert, wenn Marlene Dietrich, Zarah Leander, Paula Wessely und Leni Riefenstahl als Engel in einer Wohngemeinschaft, sprich Himmel, miteinander leben müssen? Na ja, sie putzen, kochen, streiten und singen – Lieder über den Heldinnentod, die großen Gefühle der Deutschen und über Marlenes blütenweiße Weste. Und Leni filmt natürlich.
Mit einem Wort, sie arbeiten fieberhaft an ihrem Comeback. Der Ruf nach ihnen könnte ja jederzeit wieder laut werden. Doch eine große Angst begleitet ihr Unterfangen: Hoffentlich werden keine Fragen gestellt.
Denn eines haben die vier trotz ihrer Einzigartigkeit gemeinsam: Sie reden niemals über Politik...
Veranstaltungsvorschau: Höllischer Himmel - eine Revue! - Kosmos Theater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Power GmbH
Mutter Nora schreibt in der Hoffnung auf einen Bestseller einen Ratgeber nach dem anderen, während sie ihr Leben nach dem Star ihrer Lieblingsserie ausrichtet.
Veranstaltungsvorschau: Power GmbH - neuebuehnevillach
Keine aktuellen Termine vorhanden!Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Die Lange der Nacht der Märchenerzähler
Die Erzähler der Welt werden es auch 2010 mühelos schaffen, mit Worten, Gesten und Musik die Gäste des Festivals in eine fabelhaft!e Welt zu entführen – bereits seit 24 Jahren das unumstrittene Highli
Veranstaltungsvorschau: Die Lange der Nacht der Märchenerzähler - Landestheater Niederösterreich
Keine aktuellen Termine vorhanden!Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Das Glas Wasser
Eine Aufführung des Volkstheaters in den Bezirken.
Regie: Folke Braband
Bühne: Hans Kudlich
Kostüme: Stephan Dietrich
Mit Andrea Bröderbauer, Katharina Vötter, Erwin Ebenbauer, Simon Mantei u.a.

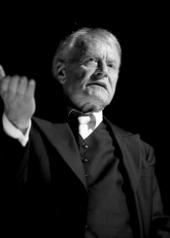








 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner 





















Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.