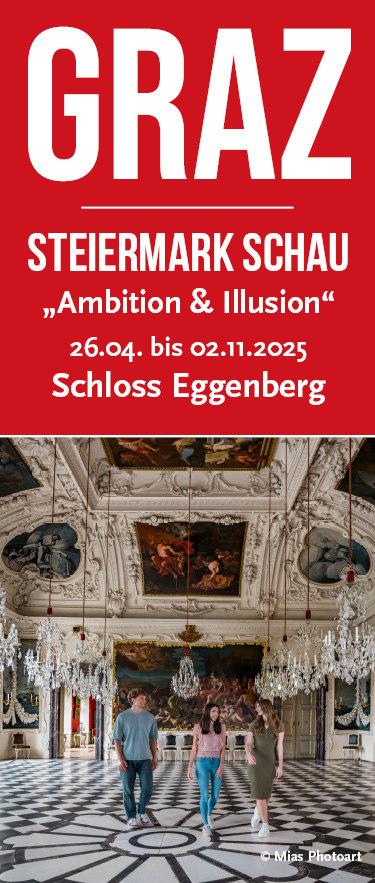Tickets und Infos Vestibül Dreier
Looking for a Missing Employee [ff]
Ein leitender Angestellter im libanesischen Finanzministerium wird von seiner Frau als vermisst gemeldet. Er ist spurlos verschwunden. Ist er zu einer Geliebten ins Ausland gezogen? Oder liegt ein Gewaltverbrechen vor? Gleichzeitig verschwindet, ebenfalls spurlos, ein Koffer mit Geld. Jeden Tag erscheinen neue, widersprüchliche Zeitungsmeldungen über den Fall, vertröstende Statements von offizieller Seite, emotional aufgewühlte von der Familie.
Autor, Regisseur und Performer Rabih Mroué aus Beirut übernimmt die Rolle eines Detektivs: Er verfolgt die Berichterstattung, sammelt akribisch alle Artikel und dokumentiert die immer unübersichtlicher werdenden Geschehnisse. Und ganz nebenbei entfaltet er mit subtiler Komik ein haarsträubendes Bild des enggewobenen Netzes der Korruption und Intransparenz der libanesischen Politik, Wirtschaft und Medien. Mroué selbst ist dabei ein präsenter Abwesender, ein packender Live-Erzähler und TV-Moderator – ausschließlich auf einem Bildschirm. Auf einem anderen verfolgen wir, wie ein Illustrator die Geschehnisse live protokolliert: Ein Wisch und schon entsteht ein ganz anderes Bild. Politisches Theater über die Halbwertszeit von Wahrheit.
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Looking for a Missing Employee [ff] - Künstlerhaus Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Karl Marx: Das Kapital, Erster Band
Das Buch, das die Ware und ihre Wertform, das Geld, die Arbeit und die Wertschöpfung analysiert, das Sergej Eisenstein (allerdings alle drei Bände) verfilmen wollte und nicht durfte und in dem so schöne Sätze stehen wie: „Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit …“ (Kapital Bd. I/III, 8).
In eine Bibliothek mit Plattenspieler, Fernseher und anderem Arbeitszubehör haben die Riminis acht Spezialisten des Alltags eingeladen, von denen zwei tatsächlich Spezialisten für Karl Marx’ Kapital sind, die meisten eher Spezialisten für Geld: Einen Blinden mit einer großen Schallplattensammlung, der durch den Abend führt und der das Kapital in Blindenschrift vorlesen kann, einen Wissenschaftler und Kenner des Werkes, einen Mitbegründer des Kommunistischen Bundes Westdeutschlands und heutigen Unternehmensberater, der seinerzeit auf der Straße Geldscheine verbrannte, einen Spielsüchtigen, einen Autor von Spekulantenbiografien, einen lettischen Filmregisseur, die Übersetzerin der Biografie von Boris Jelzin und einen jungen Aktivisten der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend mit seinen heutigen, neuen Forderungen. Indem die Experten von ihrem Leben, ihrer Arbeit und ihren Erlebnissen berichten, entsteht unterhaltsam und berührend ein Kaleidoskop der Wirkung dieses Buches auf die Welt.
In der Halle G im MuseumsQuartier!
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Karl Marx: Das Kapital, Erster Band - Halle E+G im MuseumsQuartier
Keine aktuellen Termine vorhanden!Instinct
Erzählt wird die tragische Geschichte eines kleinen Versicherungsmaklers, der für Geld und für eine Frau einen Mord begeht und dann weder die Frau noch das Geld bekommt. Neff bewohnt ein schäbiges Apartment. Er verliebt sich in die schöne Frau eines reichen Mannes, dem er eine Unfallversicherung verkaufen wollte. Daraus wird eine Lebensversicherung mit Höchstprämie. Der Mord, den das Liebespaar als Unfall tarnt, ist perfekt. Aber die Frau wird ihn verlassen. Neff hat einen besten Freund und Arbeitskollegen, der darauf spezialisiert ist, Kunden Versicherungsbetrug nachzuweisen. Er wird den Mörder überführen und seinen Freund verlieren. Bei Billy Wilder kommt Neff auf den elektrischen Stuhl. Bei Johan Simons ist die Welt schlechter: Die Versicherungsfirma kann sich einen Angestellten als Mörder nicht leisten. Der Mord wird zwei jungen Leuten in die Schuhe geschoben, der Angestellte Neff wird einer Gehirnwäsche unterzogen.
Simons erzählt die Geschichte aus der Perspektive des Mörders. In einer unaufwändigen und bewegenden Inszenierung mit zehn großartigen Schauspielern, ein paar Möbeln, Cinema-Noir-Ästhetik und a cappella gesungenen Dreißigerjahre-Songs wird der Krimi zum gesellschaftlichen Fall und zur Tragödie.
In der Halle G im MuseumsQuartier!
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Instinct - Halle E+G im MuseumsQuartier
Keine aktuellen Termine vorhanden!Der zerbrochne Krug
Das berühmte Lustspiel, in dem ein Dorfrichter in einem von ihm geführten Prozess sich selbst wider Willen als Täter entdeckt, das bei seiner Weimarer Premiere 1808 in der Regie von Goethe durchfiel und später zum Fest aller großen Schauspieler wurde, hat Peter Stein in einer scharfsinnig historisierenden Inszenierung mit Kleist’schem Aberwitz und Sehnen und politischem Sinn erfüllt.
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Der zerbrochne Krug - Theater an der Wien – Das Opernhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Der Prozess
K. darf Arbeit und Leben in Freiheit fortsetzen, aber ist von nun an auf einer verzweifelten Suche: Was ist das für ein Gesetz? Und K., so heißt es, sei prinzipiell schuldig, obwohl kein Verbrechen vorliegt.
In Andreas Kriegenburgs Inszenierung sehen die Männer, die K. verhaften, ganz genauso aus, wie K. selber. Seine Gegenspieler sind seine Doppelgänger. Überhaupt alle Personen sehen aus wie K., der ein bisschen aussieht wie Buster Keaton. Konsequent sind Text und Stoff des Romans acht Schauspielerinnen und Schauspielern als verschiedene Facetten einer multiplen Persönlichkeit übergeben. Die Bühne ist meist um neunzig Grad hochgeklappt. Wir sehen von oben auf die immer neuen Zimmer der Ämter und Amtssituationen, die K. auf seinem absurden verzweifelten Weg aufsuchen und verlassen muss. Die Schauspieler vollbringen wie selbstverständlich akrobatische Hochleistungen in einer mit Slapstick und Stummfilm spielenden Choreografie. Die Rolle des K. wird immer wieder gewechselt. Die Balance zwischen der Vervielfachung der K.-Perspektive und der subjektiven Anteilnahme an seiner Not ist verblüffend: Wir sind im Kopf von K.
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Der Prozess - Volkstheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Çirkin İnsan Yavrusu - Hässliches Menschlein [ff]
Im Gegensatz zum Entlein aus dem Märchen beginnen die Frauen jedoch, die emotionalen Spuren der Machtausübung zu formulieren. Mit Humor, überwältigendem Charme und der Körpersprache des zeitgenössischen Tanzes fordert oyun deposu das Publikum zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Position im alltäglichen Leben auf.
Im Jahr 2007 haben sich fünf junge Istanbuler Künstlerinnen um die 27-jährige Regisseurin Maral Ceranoğlu, die ihre Wurzeln im Tanz hat, zu der freien Theatergruppe oyun deposu (Stück Depot) formiert. Ziel und Antrieb war, eine Leerstelle im türkischen Theater zu schließen und heutige Lebensrealität auf die Bühne zu bringen. Bereits ihre erste gemeinsame Arbeit Hässliches Menschlein sorgte für Aufsehen. Brisanz hat schon die Figurenkonstellation: eine Frau mit Kopftuch, eine Kurdin und eine lesbische Frau – Lebenswege, die sich im normalen Istanbuler Alltag nicht kreuzen, drei Menschen, die sich aber seitens der Gesellschaft vergleichbaren Vorurteilen und Übergriffen ausgesetzt sehen.
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Çirkin İnsan Yavrusu - Hässliches Menschlein [ff] - Wiener Konzerthaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Black Tie [ff]
Für die Zeit vor dem ersten Dokument hat sie von der Adoptionsvermittlungsstelle nur die mythische Information: „Du wurdest in Südkorea 1977 in einer Schachtel gefunden, umhüllt von Zeitungspapier.“ Für Black Tie spuckt Miriam Yung Min Stein in ein Röhrchen der Firma 23andMe, macht einen Backenabstrich mit dem „genom-collector“ der Firma DeCODE me und wartet auf die Teilsequenzierungen ihres Genoms durch die beiden Marktführer. Einer der beiden empfängt sie auf der Webseite, die ihre genetischen Daten preisgeben, mit dem Slogan „welcome to you“. Der eigene Bauplan, eine Biografie? – Wie erzählt man die eigene Geschichte, wenn wie im Fall Steins ihre Aufzeichnung erst mit der Ankunft auf einem deutschen Flughafen beginnen kann?
Black Tie kreist um das schwarze Loch der Herkunft, um die befremdlich-beredte Hilfsindustrie der jungen Humangenetik und das Befremden zwischen Umwelt und mir – in Osnabrück hineinzuwachsen in einen Körper, der koreanisch wirkt, der ein ganzes Land, einen Krieg, eine andere Kultur wie in einer verschlossenen Kapsel mit sich herumträgt, unbekannt, sprachlos – ein potentieller Ort, Fluchtpunkt, Traumfabrik. Und was stand in der Zeitung, in die das Baby gewickelt war, 1977 in Südkorea?
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Black Tie [ff] - Künstlerhaus Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!(A)pollonia
Es sind erzwungene oder freiwillig erbrachte Opfer, zu mythischer Zeit, als sich die Götter noch in irdische Angelegenheiten einmischten, und im 20. Jahrhundert, als es für göttliche Intervention zu spät war und das Schicksal der Opfer nur noch Reportagestoff lieferte.
(A)pollonia sieht Opferung im Kontext von Verantwortung, in einer Welt, die die Tragödie ironisiert und entmystifiziert und zu einer ausschließlich zwischenmenschlichen Angelegenheit werden lässt. Sie verdeutlicht, was sich wirklich ereignet hat, als Iphigenie, Alkestis und Apolonia, die während des 2. Weltkriegs Juden das Leben rettete, jede ihr leises „Ja“ sagten und bereit waren, ihr Leben zu opfern. Der Autor und Regisseur montiert Texte von Aischylos, Euripides, der polnischen Journalistin Hanna Krall, J. M. Coetzee, Jonathan Littell, Rabindranath Tagore und anderen. Er zeigt ein Defilée des Todes, an dem nicht nur Menschen, sondern auch Götter und Heroen, Opfer und Henker, Schauspieler und Zuschauer teilnehmen. Er zerstört unerschütterliche Überzeugungen zum Thema Opferung: Soll dieser feierliche Akt keine Zweifel hervorrufen? Was, wenn eine Opferung andere Opfer mit sich zieht? Kann diese Prozession überhaupt aufgehalten werden?
Eine Premiere im deutschsprachigen Raum in der Halle E im MuseumsQuartier!
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: (A)pollonia - Halle E+G im MuseumsQuartier
Keine aktuellen Termine vorhanden!Рассказы Шукшина - Schukschins Erzählungen
Im Jahr 2008 wollte er mehr über das neue Russland erfahren und schlug dem Theater der Nationen vor, zehn dieser Meistererzählungen auf die Bühne zu bringen. Hermanis’ Theatersprache kennend kam diese Wahl für die Moskauer Schauspieler sehr überraschend. Der Bruch ist gewollt. Hermanis akzentuiert in seiner stimmungsvollen Inszenierung, die bei den Festwochen erstmals außerhalb von Russland zu sehen ist, den Zusammenprall zweier völlig verschiedener Welten: hier ein Staraufgebot hinreißender junger Schauspieler, allesamt Bewohner der aufstrebenden Megapolis Moskau, auf der anderen Seite die poetische Welt des einfachen, provinziellen Russland.
Und mittendrin Hermanis selbst. Seine Perspektive ist die eines Ausländers, obwohl zu gleicher Zeit im gleichen Land, der Sowjetunion, geboren. Gemeinsam mit der Fotografin Monika Pormale unternahm er eine Forschungsreise in den Geburts- und Arbeitsort Schukschins. In Srostki, gelegen im Altaigebirge nahe der kasachischen Grenze, fotografierte die Künstlerin Menschen an den Originalhandlungsorten der Erzählungen. Sie schuf daraus großformatige Bühnenprospekte, die das Spiel in eine Szenerie aus Sein und Schein versetzen.
Eine Premiere im deutschsprachigen Raum in der Halle G im Museumsquartier!
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Рассказы Шукшина - Schukschins Erzählungen - Halle E+G im MuseumsQuartier
Keine aktuellen Termine vorhanden!Dreier
Wer betrügt hier wen? Wer weiß was? Wer zieht die Fäden? Die Frau, die ihren Mann mit dessen bestem Freund betrügt? Der beste Freund? Oder der scheinbar Betrogene? Meisterhaft spielt Jens Roselt die Mittel der Komödie aus und ironisiert sie zugleich. Scharfzüngige Dialoge, viel Witz und zynische Pointen sorgen für beste Unterhaltung.
Jens Roselt arbeitet als Dramatiker, Übersetzer, Kritiker und Theaterwissenschaftler. Seit 2008 ist er Professor für Theorie und Praxis des Theaters an der Universität Hildesheim. "Dreier" wurde seit seiner Uraufführung 2002 an vielen Theatern nachgespielt und als "tragikomischer Abgesang" (Die Welt) gefeiert. Die junge Regisseurin Anik Moussakhanian, die zuletzt von Tim Crouch "Mein Arm" inszenierte, bringt das Stück auf die Bühne des Vestibüls.









 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner