Tickets und Infos Bildhauerhaus Krastal Sibylle von Halem: Skulpturen + Objekte
Die Geschichte des Burgenländischen Landesmuseums. Daten – Fakten – Bilder
Begleitend zu der durch Direktor WHR Dr. Josef Tiefenbach erfolgten wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte des Landesmuseums werden deshalb erstmals einige Räume der Familie Wolf für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In den ehemaligen Wolfräumen wird die Landesmuseumsgeschichte in Form einer mit zahlreichen Bildern bereicherten Ausstellung dargestellt. Begegnung und Forschungsgeschichte am Originalschauplatz – spürbar – nachvollziehbar – erlebbar!
Veranstaltungsvorschau: Die Geschichte des Burgenländischen Landesmuseums. Daten – Fakten – Bilder - Landesmuseum Burgenland
Keine aktuellen Termine vorhanden!Phänomen Haydn – crossover
Das Landesmuseum ist der Ort der Geschichte und der Lebenswelt, aber es ist auch ein Ort des „crossovers“, des Übergangs zwischen Gestern und Heute, zwischen dem historischen Westungarn und dem gegenwärtigen Burgenland, zwischen Ethnien und Kulturen. Haydn begegnet uns hier als ein Wanderer zwischen Welten, zwischen Hoher Kunst und Volkstraditionen. Die vielfältige Lebens- und Arbeitswelt wird anhand von Zeitgenossen Haydns illustriert.
Veranstaltungsvorschau: Phänomen Haydn – crossover - Landesmuseum Burgenland
Keine aktuellen Termine vorhanden!Mineralschätze des Burgenlandes
Das Burgenland weist trotz seiner geringen Fläche einige mineralogisch einzigartige Vorkommen auf, wie etwa das Antimonerz des ehemaligen Bergbaus von Stadtschlaining, den „Edelserpentin“ von Bernstein, die bemerkenswerten Salzminerale des Seewinkels oder die Tonminerale für die Keramikerzeugung um Stoob.
Veranstaltungsvorschau: Mineralschätze des Burgenlandes - Landesmuseum Burgenland
Keine aktuellen Termine vorhanden!Die andere Hälfte - Fokus Bildhauerinnen - Skulpturenausstellung
Die Steinbildhauerei wird zumeist als Domäne der männlichen Künstler angesehen. Doch die 42-jährige Geschichte des Symposions Krastal zeigt, dass auch Frauen kontinuierlich mit dem Material Stein arbeiten und ebenso das Bild der zeitgenössischen Steinskulptur prägen. Internationale Bildhauerinnen als auch die Mitgliederinnen des Vereins haben seit 1967 einen Beitrag dazu geleistet, das [kunstwerk] krastal zu einem der wichtigsten internationalen Zentren für Steinbildhauerei zu gestalten.
Veranstaltungsvorschau: Die andere Hälfte - Fokus Bildhauerinnen - Skulpturenausstellung - Rosstratte
Keine aktuellen Termine vorhanden!Die andere Hälfte
Teilnehmerinnen sind:
Angelika Kampfer, A
Brigitte Sasshofer, A
Christiane Neckritz, A
Caroline Ramersdorfer, A
Doris Plankl, I
Emanuela Camacci, I
Erika Inger, I
Elisabeth Juan, A
Ingrid Cerny, A
Heliane Wiesauer-Reiterer, A
Ruth Mateus-Berr, A
Sibylle von Halem, D
Rosa Brunner, D
Ursula Beiler, A
Veranstaltungsvorschau: Die andere Hälfte - Galerie Freihausgasse
Keine aktuellen Termine vorhanden!Sibylle von Halem: Skulpturen + Objekte
Die 1963 in Deutschland geborene Künstlerin studierte Bildhauerei in Glasgow, Schottland sowie in Birmingham, England, 1985 gründete sie die Glasgow Sculpture Studios, die sie bis 1996 leitete. Sibylle von Halem arbeitet seit einigen Jahren in Kärnten und ist seit 2004 Mitglied im Verein [kunstwerk] krastal.
Veranstaltungsvorschau: Sibylle von Halem: Skulpturen + Objekte - Bildhauerhaus Krastal
Keine aktuellen Termine vorhanden!Ein Fixstern am österreichischen Komponistenhimmel
Der „Componist“ (wie er selbst es schrieb) Gottfried von Einem genoss hohes Ansehen. Er war und ist weltweit bekannt, sein kompositorisches Schaffen eine Kette von nationalen und internationalen Erfolgen. Auch als Standesvertreter hatte seine Stimme in Österreich Gewicht – als Präsident, als Direktoriums- oder Kuratoriumsmitglied vieler wichtiger Kulturinstitutionen, aber auch als Gründungsmitglied so mancher neuen Kulturinitiative.
So stand Gottfried von Einem 1969 gemeinsam mit seinem Freund Helmut Wobisch an der Wiege des Carinthischen Sommers, der in den folgenden Jahrzehnten in Ossiach und Villach zum bedeutendsten Festspiel im südlichen Österreich werden sollte und dem der Meister bis zu seinem Tod 1996 auf das Engste verbunden blieb. Er beschenkte das Festspiel mit 16 Uraufführungen und mich in den 23 Jahren meiner „carinthischen“ Intendantinnentätigkeit (1980–2003) mit einer außergewöhnlichen Freundschaft, deren Säulen Vertrauen und Treue auf Gegenseitigkeit waren. In stundenlangen Gesprächen über die Musik und die Welt entdeckten wir unsere Seelen- und Geistesverwandtschaft. Unsere Freundschaft war aber auch eine spannende, manchmal spannungsgeladene, denn nicht immer und sofort herrschte absolute Übereinstimmung. Und es wäre nicht Gottfried von Einem gewesen, es wäre aber auch nicht Gerda Fröhlich, wenn wir nicht so lange um Überzeugung des Gegenübers gekämpft, die Toleranzgrenzen ausgelotet hätten, bis eine Basis gefunden war, mit der wir beide leben konnten.
So ist mir die vielleicht aufregendste Begegnung, die ich je „einfädeln“ und miterleben durfte, in lebendiger Erinnerung, das erstmalige Zusammentreffen der in ihren kompositorischen Cre-dos so unterschiedlichen Großmeister des 20. Jahrhunderts Gottfried von Einem und Ernst KrŠenek. Im August 1985 in Villach gelang das spannende Treffen der beiden „Jahrhundertkomponisten“ und endete mit einem Handschlag: KrŠenek nahm die Einladung von Einems, ein Streichtrio im Auftrag der Alban-Berg-Stiftung (deren Präsident Einem war) zu komponieren, an; im Sommer 1987, an KrŠeneks 87. Geburtstag, wurde dieses in der Stiftskirche Ossiach uraufgeführt. Fürwahr ein Stück Musikgeschichte!
Es ist für mich weit mehr als eine ehrenvolle Aufgabe, es ist mir ein sehr persönliches Anliegen, dass ich – auf Einladung der Einem-Stiftung und der Stadtgemeinde Maissau – seit 2004 das „kleine feine“ Musikfest im Gedenken an den Meister gestalten und damit postum dem großen Freund dankbare Reverenz erweisen darf.
Die 1999 ins Leben gerufenen GottfriedVonEinem-Tage finden alljährlich im Juni in Oberdürnbach bei Maissau statt. An diesem „besonderen Ort“, in der nur wenige Schritte von dem ehemaligen Einem’schen Wohnhaus entfernt gelegenen, atmosphärisch dichten Katharinenkirche, einer 700 alten ehemaligen Burgkapelle, erklingt die Musik des „Klassikers der Moderne“ für „Menschen, die sich ernsthaft für Musik interessieren, die zuhören können und wollen“, wie es dereinst Gottfried von Einem über Ossiach sagte und hinzufügte: „Dieser Ort ist sicherlich nichts für Adabeis und Schickimickis!“
Und so wollen wir gemeinsam, Künstler und Publikum, Gottfried von Einems Ossiacher Festspielvision in Oberdürnbach weitertragen: „In demütiger Stille und bedachtsamer Freude sollen wir einander behüten … Durch dieses Festspiel werden wir zur Stimme der Freundlichkeit.“
Leipzig feiert ein Universalgenie
Leipzig, die traditionsreiche Handels- und Messestadt, gilt als Boomtown des deutschen Ostens, und wer aus dem Bahnhof tritt, hinein ins Getümmel von Passanten und zahllosen Straßenbahnen, spürt: Da liegt etwas Lebendiges, Unternehmungslustiges in der Luft. Die zahlreichen historischen Bauten in der Innenstadt sind schön renoviert, von Weitem ragen das mdr-Hochhaus, Warenhäuser und Bürogebäude aus Glas und Stahl, dazwischen DDR-Moderne und vereinzelt bröckelnde Fassaden. Und immer wieder Kirchen, die Nikolaikirche, in der 1989 die friedliche Revolution ihren Ausgang nahm, und die Thomaskirche. Die Plätze sind belebt, und wie das Stadtbild, so wirken auch die Menschen: zielstrebig, aber unverkrampft. Und überdurchschnittlich kulturinteressiert, weiß Gewandhaus-Direktor Andreas Schulz: Leipzig hat nur eine halbe Million Einwohner, verfügt aber über das kulturelle Angebot einer 1,5- bis 1,8-Millionen-Stadt; allein das Gewandhausorchester hat mehr als 12000 Abonnenten. „Die Identifikation der Leipziger mit ihrem Orchester ist sehr groß, viele Abonnenten halten ihm über Jahrzehnte die Treue, und manche folgen ihm sogar auf Tourneen“, erzählt Schulz.
Bürgersinn für die Kultur Leipzig, die Bach-Stadt, ist eine der bedeutenden Musikstädte in Deutschland, und die besondere Verwurzelung des Gewandhausorchesters in der Stadt ist historisch gewachsen: Es waren Leipziger Kaufleute, die 1743 16 Musiker angestellt haben, damit sie im umgebauten Ausstellungsspeicher eines Lagerhauses der Tuchmacher Konzerte aufführten (daher die Bezeichnung Gewandhaus). Durchaus in Konkurrenz zum höfisch geprägten Dresden, wuchs aus dem Bürgersinn und -stolz der reichen Kaufmannschaft ein kulturelles Engagement, das neben dem Gewandhausorchester auch das Bildermuseum hervorbrachte und, etwa 100 Jahre später, den fast vollständig privat finanzierten Bau eines eigenen Konzertgebäudes, das nun offiziell den Namen „Gewandhaus“ erhielt. Der Gewandhaus-Kapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy war als Spross einer hoch gebildeten Kaufmannsfamilie (Großvater Moses Mendelssohn war ein bedeutender Philosoph der europäischen Aufklärung) selbst ein würdiger Repräsentant dieses politisch emanzipierten und kulturell prägenden Bürgertums – wenn auch nicht Leipziger, sondern in Hamburg geboren und in Berlin aufgewachsen und ausgebildet.
Mendelssohns Nachfolger
„Großen Respekt“ habe er empfunden, sagt Andreas Schulz, als man ihm das Amt des Gewandhaus-Direktors antrug, „Respekt vor der Tradition dieses Orchesters ebenso wie vor der Reihe beeindruckender Persönlichkeiten, die es geprägt haben“. Zu ihnen zählt auch Felix Mendelssohn Bartholdy, der die fruchtbarste Zeit seines Lebens, von 1835 bis zu seinem frühen Tod 1847, als Gewandhaus-Kapellmeister in Leipzig wirkte. Seit elf Jahren leitet der ausgebildete Kirchenmusiker und Kulturmanager Andreas Schulz die Geschicke des Gewandhauses, zunächst an der Seite des gefeierten Bruckner-Interpreten Herbert Blomstedt, der als Ehrendirigent regelmäßig ans Pult des Gewandhausorchesters zurückkehrt. Sein Vorgänger, Kurt Masur, hatte das Orchester und die Institution ein Vierteljahrhundert geführt; auch die Errichtung des Neuen Gewandhauses – des einzigen modernen Konzerthausneubaus der DDR – fiel in seine Zeit. Im Rahmen der Mendelssohn-Festtage wird Kurt Masur die Aufführung des Oratoriums Elias leiten. Heute ist Riccardo Chailly Gewandhaus-Kapellmeister und damit Nachfolger Mendelssohns; er hat den Einsatz für das Werk des Komponisten, um dessen Wiederentdeckung sich schon Kurt Masur und Herbert Blomstedt bemühten, noch intensiviert: Das reiche Œuvre, das der vielseitig begabte und rastlos tätige Felix Mendelssohn Bartholdy in seinem kurzen, an Intensität Mozart durchaus vergleichbaren Leben geschaffen hatte, wurde über lange Zeit kaum – und wenn, dann nur sehr selektiv – rezipiert.
Von Leipzig aus in die Welt
Über die Gründe wurde und wird vielfältig spekuliert: Antisemitismus im 19. Jahrhundert – man denke nur an Wagners abschätzige Äußerungen – spielt ebenso eine Rolle wie die Diffamierung durch den Nationalsozialismus; doch auch Mendelssohns zwischen Klassik und Romantik oszillierendes Schaffen selbst, das sich nicht so einfach einordnen lässt, mag dazu beigetragen haben. Unserer Zeit, die dem Extremen und Vorwärtsweisenden zugetan ist und das Brüchige, Formsprengende dem scheinbar Ausbalancierten, formal Vollkommenen vorzieht, mag Mendelssohns sich zum klassischen Formenkanon bekennende und sich zugleich darüber hinaussehnende Tonsprache erst einmal nicht radikal genug erscheinen – bis einer tiefer schürfenden Aufführung alles darin Ge- und Verborgene zu zeigen gelingt. Als leidenschaftlicher Anwalt und Botschafter Mendelssohns nimmt Riccardo Chailly mindestens ein Werk mit auf jede seiner internationalen Tourneen mit dem Gewandhausorchester, und das vierwöchige Geburtstagsfestival im Spätsommer bietet ein außerordentliches Spektrum von Werken verschiedenster Genres: Sinfonik, Chorsinfonik, Kammermusik mit Aufführungen unbekannter Lieder und, natürlich, Lieder ohne Worte. Den Oratorienaufführungen gilt in Leipzig eine besondere Verpflichtung – nicht nur, weil der Elias, zweifellos ein Hauptwerk, in den Leipziger Jahren entstand: Als einziges Konzert- (und Opern-)Orchester weltweit steht das Gewandhausorchester seit 1789 auch im Kirchendienst. Als Orchester der Thomaskirche verfügt es über eine ununterbrochene musikalische Tradition, seit Bach dort als Kantor wirkte. Andreas Schulz, als Pastorensohn mit Bach aufgewachsen und als langjähriger Chorsänger mit Bachs wie Mendelssohns oratorischem Schaffen innig vertraut, weist auf die besonderen dramatischen Qualitäten von Mendelssohns Oratorien hin.
Impulse aus der Tradition
Das Wort „Tradition“ wird großgeschrieben am Gewandhaus – aber durchaus im Mahler’schen Sinn als Weitergabe des Feuers, nicht als Anbetung der Asche. „Die Frage ist doch, wie man mit Tradition umgeht“, meint Andreas Schulz. „Mache ich konservierende Programme, die nur das Alte abbilden, oder ergründe ich, welche Impulse die ‚Alten‘ ihrer Zeit gegeben haben? Und gerade Mendelssohn steht ja wie kaum ein anderer für neue Impulse.“ So bestand der frisch gebackene Kapellmeister bei seiner Berufung nach Leipzig darauf, nicht nur bei Aufführungen von Chorwerken, sondern stets als musikalisch Verantwortlicher Weisungsrecht auszuüben; anfänglicher Widerstand verstummte rasch, da sich die Aufführungsqualität in der Folge bald deutlich verbesserte. Als zeitweiliger Reformator des preußischen Musiklebens und Organisator des Rheinischen Musikfests war Mendelssohn auch Vorläufer eines heutigen Kulturmanagers. Zugleich setzte sich Mendelssohn zu seiner Zeit intensiv mit Tradition auseinander: In Berlin hatte er die erste Wiederaufführung der Matthäus-Passion nach Bachs Tod durchgesetzt und wiederholte sie in Leipzig. Außer Bach führte er auch Händel und andere Tonsetzer des Barock auf, was damals ganz unüblich war, und veranstaltete ab 1838 sogenannte historische Konzerte, weil er die Beschäftigung mit Musik der Vergangenheit als förderlich für das Musikverständnis des Publikums ansah.
Blick zurück und Blick nach vorn
Daran knüpft Andreas Schulz heute wieder an und stellt pro Saison zwei, drei Konzertprogramme aus der Zeit des ersten Gewandhauses erneut zur Diskussion – ein Abenteuer, denn natürlich haben sich die Wahrnehmungsperspektive, die Aufführungsgepflogenheiten und damit auch der „Geschmack“ seither verändert: Gilt unserer Zeit die vollständige Aufführung eines Werks mit allen Sätzen, in möglichst historisch-kritisch gesicherter Gestalt, als Grundgesetz, kombinierte man im 19. Jahrhundert viel unbekümmerter einzelne Sätze aus verschiedensten Werken in zuweilen verblüffend abwechslungsreichen und teilweise sehr langen Konzerten. Andererseits verfolgte Mendelssohn das Musikschaffen seiner Zeitgenossen und führte zahlreiche neue Kompositionen, etwa von Robert Schumann, auf. Auch diesem Impuls folgen Schulz und das Gewandhausorchester: Uraufführungen und Erstaufführungen sind regelmäßige Bestandteile jeder Konzertsaison; im Jubiläumsjahr konnten – auch dank der Unterstützung der Ernst-von-Siemens-Stiftung, die Kompositionsaufträge finanziert – drei Aufträge vergeben werden: Detlev Glanert, Georg Friedrich Haas und Sir Peter Maxwell Davies reagieren in ihren Kompositionen auf die Musik Mendelssohn Bartholdys; die Werke werden jeweils mit einem Mendelssohn-Opus in entsprechender Besetzung aufgeführt. „In der Tradition steckt ein Schatz von Ideen; wenn es gelingt, sie kreativ umzusetzen, kann man Interessantes und Neues anbieten“, fasst Andreas Schulz seine Haltung zur Tradition zusammen.
Ausblick
„Mendelssohn war ein Universalgenie, wie man es selten findet – als Musiker, Komponist und Dirigent ebenso wie als bildender Künstler und Literat. Es ist ihm so vieles gelungen – nicht nur als Begründer des modernen Dirigententums; er hat sich ja um alles gekümmert, um den Pensionsfonds für die Musiker ebenso wie um die Gründung des ersten Konservatoriums, der heutigen Leipziger Musikhochschule. Wenn man dann noch bedenkt, wie die Möglichkeiten damals waren – kein Telefon, keine E-Mails, sondern Pferdepost und Reisen in der Kutsche –, ist das eine außerordentliche Leistung.“ Die Festtage in Leipzig werden dazu beitragen, Felix Mendelssohn Bartholdy in seiner Vielseitigkeit besser kennenzulernen und zu würdigen. Auf welches Konzert während der Festtage freut sich Andreas Schulz am meisten? „Der Gewandhaus-Direktor“, antwortet er lächelnd, „freut sich auf alle gleichermaßen, ich persönlich besonders auf Elias. Ich werde jedes Wort in Gedanken mitsingen.“
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Das Leben in Roms Donaumetropole
Großes Carnuntiner Römerfest
Am 6. und 7. Juni herrscht in Carnuntum, der römischen Metropole an der Donau, der Ausnahmezustand: Rund 200 römische Teilnehmer – bestehend aus Legionstruppen und Gladiatoren, Handwerkern und Händlern – haben wieder ihr Lager im Archäologischen Park Carnuntum aufgeschlagen. Es beginnt ein Spektakel, das die Besucher in eine Zeit versetzt, die gut 2000 Jahre in die Vergangenheit führt. Triumphzüge römischer Legionen führen dem gespannten Publikum vor Augen, was sich in der Antike an diesem Ort zugetragen hat. Auf dem ganzen Gelände bieten Handwerker und Händler ihre Waren feil. Die Kunst des Kochens nach antiken Rezepten trägt dazu bei, das alte Carnuntum mit allen Sinnen erfahren zu können.
Bei dieser Zeitreise darf aber auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Erlesene Köstlichkeiten, nach überlieferten römischen Rezepten hergestellt, und Spitzenweine aus der Region Carnuntum entführen in die sinnliche Welt römischer Genusskultur.
Junge Römer sind eingeladen, mit Julius Carnuntinus auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise durch Carnuntum zu gehen. Bei dieser speziellen Julius-Tour gilt es, allerlei Sonderprüfungen zu bestehen und dem aufregenden Leben eines reichen Römers auf die Spur zu kommen. Dazu haben Kinder die Möglichkeit, sich im Exerzieren zu üben, ein römisches Schwert zu basteln, alten Märchen und Sagen zu lauschen und vieles mehr.
6. und 7. Juni 2009, 10–18 Uhr
Freilichtmuseum Petronell
Gladiatoren in der Arena
Im Jahr 2009 kehren die Gladiatoren wieder nach Carnuntum zurück. Die Vorführungen im Amphitheater Bad Deutsch-Altenburg zeigen, wie der Ablauf von antiken Gladiatorenkämpfen wirklich war. Ausrüstung und Kampftechnik wurden bis ins kleinste Detail rekonstruiert und geben fesselnde Einblicke in die Welt der Arena.
Gladiatorenkämpfe waren ein elementarer Bestandteil der römischen Kultur. Ursprünglich Teil des etruskischen Totenkults, mutierten die Gladiatorenkämpfe unter den Römern zu jenen blutrünstigen Spektakeln, die wesentlich unser Bild von der römischen Antike prägen. Auch in Carnuntum kämpften Gladiatoren vor bis zu 8000 Zusehern auf Leben und Tod. Anders als in Kinofilmen dargestellt, waren die Kämpfe nicht immer ein Massengemetzel, sondern Zweikämpfe mit festgelegten Regeln und fixen Waffengattungen. Verachtet und umjubelt zugleich, führten die antiken Gladiatoren ein Leben zwischen Familie und Arena.
Die Vorführungen der Gladiatoren rund um Marcus Junkelmann beginnen wie schon zur Zeit der Römer mit dem feierlichen Einzug der Gladiatoren zu originalgetreuer römischer Musik. Vor den kommentierten Schaukämpfen wird nach einer überlieferten, jahrtausendealten Zeremonie die Schutzgöttin Nemesis um ihre Gunst angerufen. Danach erfolgt die Bewaffnung der Gladiatoren.
20./21. Juni, 18./19. Juli, 22./23. August 2009,
jeweils um 14 und 16 Uhr, Amphitheater
Bad Deutsch-Altenburg
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Bretter, welche die Welt bedeuten …
Seinen eigentlichen Ruhm verdankt das Städtchen jenem Theater, das dort im Jahr 1802 nach Plänen von Heinrich Gentz und unter Mitwirkung Johann Wolfgang von Goethes errichtet worden ist. Das klassizistische Lauchstädter Sommertheater – Goethe-Theater – ist die einzige original erhaltene Wirkungsstätte von Johann Wolfgang von Goethe. 1802 wurde es nach seinen Vorgaben errichtet. Bis 1814 trat die Weimarer Hofschauspielergesellschaft unter seiner Leitung auf. 1834 begann Richard Wagner hier seine Laufbahn als Dirigent.
Heute werden Stücke von Goethe, Schiller und anderen Künstlern dieser Zeit aufgeführt. Sehenswert sind die Historischen Kuranlagen (1776–1787). Nach der Entdeckung der Heilquelle um 1700 avancierte der Ort im 18. Jahrhundert zum Modebad des Adels und reicher Bürger. Das Heilwasser wird heute als „Lauchstädter Heilbrunnen“ angeboten. Die Historischen Kuranlagen sind ganzjährig frei zugänglich.
Das aus einer Wasserburg des 14. Jahrhunderts hervorgegangene Schloss diente den Merseburger Bischöfen als Sommerresidenz und später dem Dresdner Kurfürsten während seiner Badeaufenthalte.
Neben den künstlerischen Angeboten des Theatersommers und des Konzertwinters sind es vor allem die regelmäßigen Führungen, die Einblicke in die Tradition und Gegenwart Bad Lauchstädts gestatten.
Theatersommer 2009
Die Zauberflöte
von Wolfgang Amadeus Mozart
1., 2., 30. und 31. Mai; 19. und 20. September;
3. und 4. Oktober 2009
Die Entführung aus dem Serail
von Wolfgang Amadeus Mozart
16. und 17. Mai; 20. und 21. Juni 2009
Die Hochzeit des Figaro
von Wolfgang Amadeus Mozart
29. und 30. August; 26. und 27. September 2009
Pimpinone
von Georg Philipp Telemann
Bastien und Bastienne
von Wolfgang Amadeus Mozart
23. August 2009
Faust – Der Tragödie erster Teil
von Johann Wolfgang von Goethe
9. (Premiere) und 10. Mai;
5. und 6. September 2009
Die Gretchentragödie
von Johann Wolfgang von Goethe
22. August 2009
Nathan der Weise
von Gotthold Ephraim Lessing
23. und 24. Mai 2009
Minna von Barnhelm
von Gotthold Ephraim Lessing
12. und 13. September 2009
Wilhelm Tell
von Friedrich Schiller
4. und 5. Juli 2009
Thomas Mann
mit Dagmar Frederic als Christiane von Goethe
22. August 2009, 18 Uhr, im Historischen Kursaal
Das Jalta-Spiel
mit Daniel Minetti
27. Juni 2009
Vater Wiecks Liebe
mit Rolf Hoppe
28. Juni 2009
Goethe Werther Eisermann
mit André Eisermann
11. Juli 2009
Christian Quadflieg
liest Friedrich von Schiller
11. Oktober 2009
Festspiel der Deutschen Sprache
Initiatorin: Prof.in Edda Moser
Schirmherrschaft: Prof. Dr. Wolfgang Böhmer, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt
11. September 2009, 19 Uhr
Die Vorstellungen beginnen, wenn
nicht anders angegeben, um 14.30 Uhr.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.










 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner 


















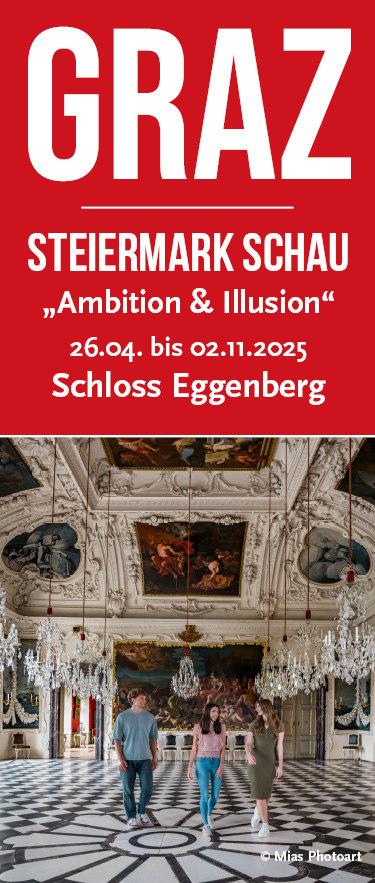







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.