Tickets und Infos Theater an der Wien – Das Opernhaus Il Turco in Italia
Der Barbier von Sevilla
Sprühende Melodien, mitreissende Rhythmen, virtuoser Bravourgesang und nicht zuletzt ein geistreich-witziges Libretto: Dieses basiert auf dem ehemals sehr beliebten Lustspiel von Beaumarchais, das bereits mehrfach vertont worden war (die Fortsetzung der Rossinischen Handlung liefert dann Mozarts „Figaro“). Im Zentrum der turbulenten Handlung steht der berühmteste Barbier aller Zeiten, der hilft, dass der Graf Almaviva doch noch seine geliebte Rosina in die Arme schließen darf. Das erweist sich als gar nicht so einfach, will der Graf inkognito doch erst die aufrichtigen und uneigennützigen Gefühle Rosinas ergründen. Er stellt sich ihr deshalb als Student Lindoro vor … Erschwerend kommt noch hinzu, dass Dr. Bartolo, Rosinas Vormund, ebenfalls ein Auge auf sie geworfen hat, um an deren reiches Erbe zu kommen. Aus dieser Situation heraus entwickelt sich ein Verwirrspiel von Maskerade, Täuschungen und Intrigen, das aber zu guter Letzt doch noch zu einem Happy End führt.
Veranstaltungsvorschau: Der Barbier von Sevilla - Salzburger Landestheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Rigoletto im Römersteinbruch Sankt Margarethen
Im Mittelpunkt von Giuseppe Verdis Oper Rigoletto steht die Geschichte von Rigoletto, dem Hofnarren des Herzogs von Mantua. „Im Jahr 2009 erwartet Opernliebhaber im Römersteinbruch Verdis Rigoletto mit dem Opernhit ‚La donna è mobile‘. Die Inszenierung des italienischen Regisseurs Renzo Giacchieri lässt die mächtige Naturkulisse durch meisterliche Musik, prächtige Bilder und Fantasie erstrahlen. Das Publikum darf sich auch im kommenden Sommer auf ein opulentes Fest für die Sinne freuen!“, so Wolfgang Werner.
„Der großartigste Stoff und vielleicht das größte Drama der Moderne“, schrieb Verdi über Victor Hugos Drama Le roi s’amuse begeistert und verwendete es für seine in einem wahren Schaffensrausch komponierte Oper. Der Librettist bearbeitete den Stoff von Victor Hugo, indem er den Schauplatz von Paris nach Mantua verlegte und die historischen Figuren in fiktive verwandelte.
Um schließlich auch die Darstellung königlichen Fehlverhaltens zu umgehen, wurde in Verdis Oper der Hofnarr Rigoletto zur Titelfigur. Der eigenartige Sonderling ist nicht besonders beliebt bei den Höflingen. Sie haben erfahren, dass Rigoletto nächtens heimlich eine junge Frau besucht. Wie es scheint, eine Geliebte. Sie machen sich einen besonderen Spaß daraus, die Schöne zu entführen. Was keiner weiß: Die junge Frau namens Gilda ist Rigolettos Tochter, die er vor dem verderbten Herzog und der Hofgesellschaft zu verstecken versucht. Doch längst hat der Herzog Gilda ausfindig gemacht und ihr Herz erobert.
Rigoletto plant, mit seiner Tochter die Stadt zu verlassen. Doch vorher will er noch Rache nehmen. Mit Sparafucile, einem bezahlten Mörder, handelt er den Preis für die Leiche des Herzogs aus. Gilda wird von ihrem Vater zum Haus des Herzogs geführt, um sie von dessen Untreue zu überzeugen. Sie belauscht das Gespräch zwischen ihrem Vater und Sparafucile und beschließt, für den Geliebten zu sterben. Die Leiche, die Rigoletto am Ende übergeben wird, ist die seiner eigenen Tochter.
Rigoletto, bis heute eine der meistgespielten Opern Verdis, ist die erste der „Trilogia popolare“, zusammen mit Il Trovatore und La Traviata. Die Premiere 1851 in Venedig wurde enthusiastisch gefeiert und begründete Verdis Weltruhm.
Mit dem Konzept „Oper für jedermann“ sprechen die Opernfestspiele Sankt Margarethen ein breites Publikum an. Seit 1996 werden auf Europas größte Naturbühne im Römersteinbruch Sankt Margarethen großartige Inszenierungen bekannter Opernwerke unter freiem Himmel gezeigt. Der bizarre Steinbruch wird auch im kommenden Sommer durch meisterliche Musik, prächtige Bilder und Fanta-sie zum Schauplatz für unvergessliche Opernerlebnisse unter freiem Himmel! Vom 8. Juli bis 23. August 2009 wird mit Verdis Rigoletto die Erfolgsstory der Festspiele fortgesetzt.
Oper im Römersteinbruch Sankt Margarethen ist ein Kulturerlebnis und ein „Fest für alle Sinne“. Hervorragende burgenländische Weine, kulinarische Schmankerln und die Gastfreundschaft der Menschen laden ein zum Genießen! Auch abseits der Bühne legen die Opernfestspiele Wert auf erstklassige Qualität.
Römersteinbruch exklusiv mit Elı¯na Garancˇa und Hubert von Goisern
In der Reihe „Römersteinbruch exklusiv“ präsentieren die Opernfestspiele Sankt Margarethen jedes Jahr Konzerte mit bekannten Weltstars. Im kommenden Sommer gastieren zwei Größen im Römersteinbruch: Am 12. Juni 2009 eröffnet Elı¯na Garancˇa erneut die Festspielsaison, und am 13. Juni 2009 tritt der österreichische Ausnahmekünstler Hubert von Goisern ebenfalls in der Felsenarena auf.
Spaß und sieben Streiche bei der Kinderoper Max & Moritz
Alle jungen und jung gebliebenen Musikliebhaber kommen in „Papagenos Opernwelt“ auf ihre Kosten: Nach dem großartigen Erfolg in der letzten Saison stehen die lustigen Lausbubenstreiche von Max & Moritz im Jahr 2009 erneut auf dem Programm! Die sieben Streiche, erzählt von Kammersänger Heinz Holecek, der in die Rolle des Wilhelm Busch schlüpft, und die lebhafte Musik von Alexander Blechinger begeisterten bereits im vergangenen Jahr mehr als 20000 große und kleine Besucher.
Familienvorstellungen: 20., 21., 27. und
28. Juni; 4. und 5. Juli 2009, 17 Uhr
Schulvorstellungen: 23., 24., 25., 26. sowie
29. und 30. Juni 2009, 10 Uhr
Wo die Magie der Oper lebt
Für die hohe künstlerische Qualität garantieren sowohl die Dirigenten Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Christophe Rousset, Bertrand de Billy, Kirill Petrenko und Fabio Luisi als auch Opernregisseure wie Martin Kusˇej, Christof Loy, Claus Guth, Keith Warner, Laurent Pelly, Stephen Lawless oder Pierre Audi. Hochkarätige Sänger(innen) wie Natalie Dessay, Angelika Kirchschlager, Anne Sofie von Otter, Christine Schäfer, Soile Isokoski, Erwin Schrott, Kurt Streit, Bo Skovhus, Richard Croft, Bejun Mehta, David Daniels und viele andere sind in außergewöhnlichen Projekten am Theater an der Wien zu sehen.
Pelléas et Mélisande von Claude Debussy
Kaum ein Werk ist so ätherisch und tragisch wie dieses: Die unglückliche Geschichte der Liebenden Pelléas und Mélisande gilt als Juwel des Symbolismus. Nach dem großartigen Erfolg mit den Dialogues des Carmélites von Francis Poulenc übernimmt Bertrand de Billy die musikalische Leitung für diese Neuproduktion. Unter seinem Chefdirigenten spielt das Radio-Symphonieorchester Wien. Regisseur und Kostümbildner Laurent Pelly inszeniert die „traumhafte Atmosphäre“ des symbolistischen Operndramas, das am 13. Januar 2009 Premiere hat. Im Zentrum dieser außergewöhnlichen Produktion stehen Natalie Dessay in der Rolle der Mélisande und Stéphane Degout als Pelléas.
ab 13. Januar 2009
Partenope von Georg
Friedrich Händel
Bei dieser Produktion zeichnet der französische Barockspezialist Christophe Rousset für die musikalische Leitung verantwortlich: Partenope gehört zweifellos zu den besten von Händels insgesamt 35 Londoner Opern. Der frische, einprägsame Stil und das hervorragende Textbuch machen diese Oper zu etwas ganz Besonderem. Das Theater an der Wien zeigt das Werk in einer Neuproduktion mit Starbesetzung: Christine Schäfer, David Daniels und Kurt Streit. Für den perfekten Klang sorgt das Ensemble Les Talens Lyriques.
ab 22. Februar 2009
Messiah – das Oratorium als Paraphrase
über die Erlösung der Menschheit szenisch auf der Opernbühne!
Nach dem großartigen Erfolg mit Mozarts Lucio Silla im Jahr 2006 kehrt Regisseur Claus Guth für diese Neuproduktion, die am 27. März 2009 Premiere hat, an das Theater an der Wien zurück. Jean-Christophe Spinosi dirigiert das Ensemble Matheus und den Arnold Schoenberg Chor (Leitung: Erwin Ortner).
Premiere: 27. März 2009
Theater an der Wien im Haydn-Jahr 2009
Aus Anlass des 200. Todestags Joseph Haydns bringt Nikolaus Harnoncourt, der im Jahr 2009 seinen 80. Geburtstag feiert, Haydns wohl berühmteste Oper, Il mondo della luna, am 5. Dezember 2009 zur Premiere. Die Inszenierung liegt in den Händen von Tobias Moretti.
Bis Jahresende 2009 gibt es von dieser Produktion fünf weitere Aufführungen im neuen Opernhaus Theater an der Wien, das zu den schönsten und traditionsreichsten Bühnen in Wien zählt. Durch seine hervorragende Akustik und das authentische, intime Ambiente ist das 1801 erbaute Theater an der Wien ein idealer Aufführungsort für die Werke von Joseph Haydn.
Zum Geburtstag von Joseph Haydn spielt am 31. März das Ensemble Matheus unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi die Sinfonien Der Bär und Die Henne; Mezzosopranistin Susan Graham singt Arien von Haydn und Mozart.
Im Rahmen des OsterKlang-Festivals bestreitet Riccardo Muti mit den Wiener Philharmonikern das Eröffnungskonzert am 4. April im Wiener Musikverein. Auf dem Programm stehen Haydns Sieben letzte Worte. Haydns Stabat Mater erklingt unter der Leitung von Martin Haselböck mit seiner Wiener Akademie am 8. April.
Haydns Oper L’isola disabitata (Die unbewohnte Insel) wird am 12. Juli konzertant mit dem L’Orfeo-Barockorchester aufgeführt.
Das Kabinetttheater erzählt die große Oper mit seinen Mitteln – den vielen Möglichkeiten des Figurentheaters. Ab 14. März reagiert das Ensemble mit der Miniaturoper Haydn bricht auf auf den Spielplan des Theaters an der Wien, durchleuchtet Musik, Geschichte und das Haydn-Gedenkjahr 2009. Die Uraufführung widmet sich dem Geburtstagskind Haydn mit Kompositionen und Arrangements des österreichischen Komponisten Bernhard Lang. Spielort ist die „Hölle“ im Souterrain des Theaters, das bis 1936 als Musikkabarett bespielt wurde.
Termine 2009
Haydn bricht auf: 14., 15., 19., 20. und 22. März 2009
Zum Geburtstag von Joseph Haydn:
31. März 2009
Sieben letzte Worte (Wiener Philharmoniker/Riccardo Muti; Eröffnung OsterKlang): 4. April 2009
Stabat Mater (OsterKlang): 8. April 2009
L’isola disabitata: 12. Juli 2009
Il mondo della luna: 5., 7., 9., 11., 13. und 22. Dezember 2009 (geplant; Kartenverkauf ab Mai 2009)
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Hänsel und Gretel
Bis heute gilt Hänsel und Gretel als die klassische Märchenoper schlechthin, die mit ihrer Mischung aus spätromantischer Orchestersprache, Volksliedern und im volkstümlichen Stil komponierten Melodien wie "Suse, liebe Suse", "Brüderchen, komm tanz mit mir" oder "Ein Männlein steht im Walde" gleichermaßen dazu angetan ist, die Herzen aller jungen und jung gebliebenen Zuschauer zu erobern.
Veranstaltungsvorschau: Hänsel und Gretel - Stadttheater Klagenfurt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Roméo et Juliette
Die Vertonung der wohl bekanntesten tragischen Liebesgeschichte aller Zeiten bescherte Charles Gounod seinen größten Bühnenerfolg. Zwei junge Leute verlieben sich unsterblich ineinander, doch ihr Weg in eine gemeinsame Zukunft erscheint wegen der erbitterten Feindschaft ihrer Familien ausweglos. Nach rasanten Ballszenen, überhitztem Duell, heimlicher Hochzeit und durch unglückliche Verstrickungen finden sie den Tod.
Veranstaltungsvorschau: Roméo et Juliette - Tiroler Landestheater - Großes Haus
Keine aktuellen Termine vorhanden!La Calisto
Jupiter hat ein Auge auf die Nymphe Calisto geworfen. Als Gefährtin der Jagdgöttin Diana hat Calisto jedoch ein Keuschheitsgelübde abgelegt. Wie üblich vertraut Jupiter weniger auf seine Verführungs als auf seine Verwandlungskünste. In Gestalt Dianas nähert er sich der nichts ahnenden Nymphe. Während der Gott alles andere als vorbildhaftes Gebaren an den Tag legt, zeigt sich der neben Calisto einzige Sterbliche dieser Geschichte, der Schäfer Endimione, als aufrichtig Liebender. Leider ist er in Diana verliebt, was zu entsprechenden Verwechslungen führt. Calisto muss schließlich dafür büßen, dass sie Jupiters Verkleidungsspielchen nicht durchschaut hat. Jupiters eifersüchtige Frau Juno verwandelt sie aus Rache in eine Bärin – allerdings ohne Möglichkeit der Rückverwandlung wie sie der Göttervater besitzt. Mit einem flauen Trost versucht Jupiter vor Calisto die Rolle des würdevollen Gottes aufrecht zu erhalten: Er würde sie nach ihrem Tod als Sternbild des Bären an den Himmel und damit in seine Nähe versetzen.
Veranstaltungsvorschau: La Calisto - Landestheater Linz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Intermezzo
Kapellmeister Storch muss dienstlich nach Wien. Unverhoffte Post aus der Hauptstadt lässt seine Frau Christine zuhause am Grundlsee die Fassung verlieren: "Lieber Schatz, schicke mir doch wieder zwei Billetts morgen zur Oper, nachher in der Bar, wie immer, Deine Mieze Meier." Verärgert eilt sie sogleich zum Notar, um die Scheidung einzureichen. An ihren Mann schickt sie das unmissverständliche Telegramm: "Wir sind für immer geschieden!". Als Storch dies liest, verlässt er bestürzt eine Skatrunde und irrt fassungslos im Prater umher. Doch der ominöse Brief hat den falschen Empfänger erreicht, er war an Kapellmeister Stroh gerichtet, und Mieze Meier hat die beiden Namen verwechselt. Versöhnung im Hause Storch.
Veranstaltungsvorschau: Intermezzo - Theater an der Wien – Das Opernhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!aktionstheater ensemble: Paradiesseits
Anlässlich von „20 Jahre aktionstheater ensemble“ im Jahr 2009 nimmt sich das Leading Team des Ensembles wieder eines gesellschaftlich brisanten Themas an: Über ein Jahr hat der Komponist Gerald Futscher, ein Meister der musikalischen Verdichtung, an der Sprechoper „Paradiesseits“ geschrieben. Mit dem auf zeitgenössische Musik spezialisierten Kammerorchester ensemble plus (Leitung: Andreas Ticozzi) wird Dirigent Kasper de Roo das Werk im Festpielhaus Bregenz zur Uraufführung bringen. Regisseur Martin Gruber inszeniert – mit einem Libretto des Sprachkünstlers Andreas Staudinger – „Paradiesseits“ als Antithese zur heutigen juvenil gestylten Spaßgesellschaft. Ein ebenso anarchischer wie berührender Abend über das Leben, die Liebe, Sexualität und Einsamkeit in einem Altersheim, in dem es zu einem Missverständnis kommt: Statt eines Schlagersängers wird für das Nachmittagskränzchen ein Brautkleidverkäufer und Weddingplaner gebucht. Doch was soll’s, statt geschunkelt wird eben geheiratet. Schon werden Junggesellinnen- und Junggesellenpartys ausgerichtet, Dessous anprobiert, der Champagner eingekühlt. Doch dann geschieht das Unfassbare...
Bregenzer Frühling
Veranstaltungsvorschau: aktionstheater ensemble: Paradiesseits - Festspielhaus Bregenz / Werkstattbühne
Keine aktuellen Termine vorhanden!Don Giovanni
Die Geschichte des erotischen Verführers und Vergewaltigers, des Gotteslästerers und aristokratischen Kavaliers sowie des Narziss und Mörders in einer Person inspirierte Mozart und seinen Librettisten Da Ponte zu einer Komposition, in der die tragischen und heiteren Elemente zu einer Einheit verschmelzen.
Veranstaltungsvorschau: Don Giovanni - Theater an der Wien – Das Opernhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Il Turco in Italia
Fiorilla hat ihren Ehemann Don Geronio satt. Doch auch ihres Liebhabers Don Narciso ist sie längst überdrüssig geworden. Da kommt der reiche Türke Selim, der in Italien erotische Zerstreuung sucht, gerade wie gerufen. Dieser lässt sich Fiorillas Zärtlichkeiten gerne gefallen, mag aber gleichzeitig auch nicht auf seine frühere Liebschaft Zaida verzichten, die plötzlich auftaucht, um ihren Mann zurück zu erobern. Nach Eifersuchtsszenen, gescheitertem Frauenhandel, Entführungsversuchen, einem Maskenball, Verwechslungen und Versöhnungen winkt ein Happy End: Selim reist mit Zaida heim, Fiorilla kehrt reumütig zu Don Geronio zurück, und Don Narciso widmet sich neuerdings wieder seinem galanten Handwerk.

























 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner 


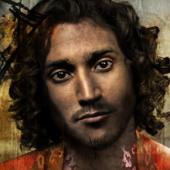













Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.