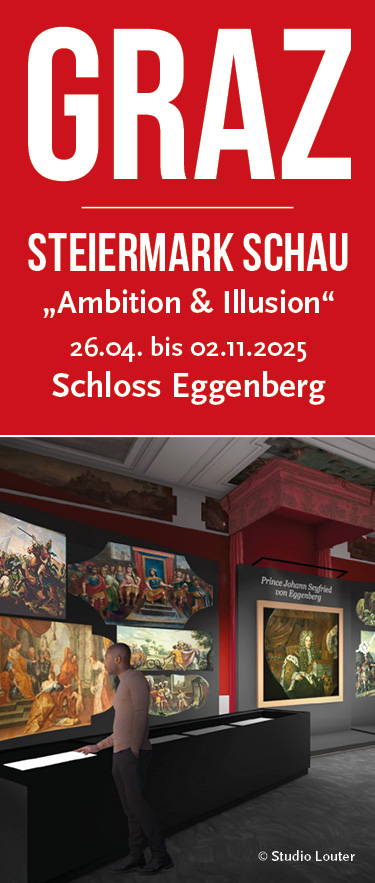Tickets und Infos Volkstheater Wien denkBAR: Wie rechts ist Österreich?
Das Reflektorium - Zwischen Künstlicher Intelligenz und Idiotie des Künstlers
Zur dritten Ausgabe des Reflektoriums erwartet Stefan Zweifel den Dekonstruktionsromancier, Exilgastronomen und Kybernetikphilosophen Oswald Wiener. Im Spannungsfeld zwischen Künstlicher Intelligenz und künstlerischer Idiotie begeben Wiener und Zweifel sich auf Themensuche und maßschneidern dabei den einen oder anderen Glücksanzug – auf der Suche nach dem zeitgemäßen Servo-Narziss. Und vielleicht schalten sich ja Flauberts Bouvard und Pécuchet mit einer Weinverkostung ein. Oswald Wiener war der Kopf der „Wiener Gruppe“ (1954-1964), die neben der Situationistischen Internationalen und der Independent Group zu den radikalsten Künstlervereinigungen im Nachkriegseuropa zählt, und tritt heute bei diversen Kongressen auf, die sich mit philosophisch-poetischen Implikationen von Künstlicher Intelligenz beschäftigen.
Stefan Zweifel hat Philosophie und Ägyptologie studiert, über de Sade/Hegel/Lametrie promoviert und lebt als Publizist, Ausstellungskurator und Übersetzer in Zürich. Er ist Mitglied des Literaturclubs im Schweizer Fernsehen.
Veranstaltungsvorschau: Das Reflektorium - Zwischen Künstlicher Intelligenz und Idiotie des Künstlers - Vestibül
Keine aktuellen Termine vorhanden!1. öffentliches Publikumsgespräch
Das 1. öffentliche Gespräch des Publikumsforums mit dem neuen Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann findet am 26. November 2009 um 18 Uhr im Burgtheater, 2. Pausenfoyer, statt.
Veranstaltungsvorschau: 1. öffentliches Publikumsgespräch - Burgtheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Künstlergespräch mit Mirella Freni
Die 1935 in Modena geborene Sopranistin zeigte schon sehr früh ihre musikalische Begabung und sang schon mit zehn (!) Jahren "Un bel dì vedremo" aus Puccinis Butterfly in einem Radio-Wettbewerb der RAI. Bei diesem frühen Erfolg spielte natürlich auch der familiäre Hintergrund eine entscheidende Rolle: Der Vater war Barbier, die Mutter arbeitete - wie übrigens auch die Mama von Luciano Pavarotti - in der ortsansässigen Zigarettenfabrik. Die große Leidenschaft der Eltern war die (Opern-) Musik, die für die kleine Mirella früh zum ständigen Begleiter wurde.
Der kindliche Ehrgeiz fand allerdings ein schnelles Ende, als Beniamino Gigli vor den Gefahren eines frühen Stimmverschleißes warnte und zu einer klassischen Gesangsausbildung riet, die sie aber erst in ein paar Jahren beginnen sollte. Doch auch das professionelle Bühnendebüt absolvierte die Künstlerin bereits in einem Alter, in dem sich die meisten zukünftigen SängerInnen meist noch mit der Aufnahmeprüfung für die Hochschule herumschlagen: Mit 19 Jahren sang sie in ihrer Heimatstadt die Micaela in Bizets Carmen.
Ein steiler Karriereverlauf wäre mit dem Erfolg vorgezeichnet gewesen, doch für die nächsten zwei Jahre stand das Privatleben im Mittelpunkt, da sich in der Ehe mit ihrem Gesangslehrer Leone Magiera früh Nachwuchs einstellte. Der internationale Durchbruch gelang Freni Anfang der 60er Jahre in Glyndebourne als Adina in Donizettis Elisir d'amore. Von nun an folgte Debüt auf Debüt: 1961 stellte sie sich als Nanetta, dem Publikum des Londoner Royal Opera House Covent Garden vor, zwei Jahre später folgte die Mailänder Scala in einer von Herbert von Karajan dirigierten Bohème, die auch den Beginn der intensiven Zusammenarbeit der beiden Künstler markierte. In derselben Oper debütierte sie zwei Jahre später auch an der New Yorker MET.
Ihren Einstand an der Wiener Staatsoper feierte die Freni im November 1963 in der von Herbert von Karajan dirigierten und von Franco Zeffirelli inszenierten neuen Bohème, die hohe Wellen schlug, da sie die erste italienisch gesungene Inszenierung des Werks im Haus am Ring war und wegen eines Streiks verschoben werden musste.
Von den 60er Jahren an assoziierte man die Künstlerin mit der Mimì, die sie - auch in Wien - bis in die 90er Jahre in ihrem Repertoire behielt. Es zeugt von Frenis technischer Souveränität, dass sie diese lyrische Partie parallel zu dramatischeren Rollen wie der Elisabetta im Don Carlo, Aida, Elvira (Ernani) oder der Amelia Grimaldi in Simon Boccanegra singen konnte. Besonders die Verdi-Rollen ermöglichten es der Künstlerin, gemeinsam mit ihrem zweitem Ehemann Nicolai Ghiaurov, den sie 1981 heiratete, auf der Bühne zu stehen.
In den 90er Jahren stellte sich die Sängerin mit Rollen wie Adriana Lecouvreur, Fedora, Lisa (Pique Dame) sowie der Titelrolle in Giordanos Madame Sans-Gene neuen Herausforderungen. Die Künstlerin beendete ihre Bühnenlaufbahn im April 2005 in Washington mit Tschaikowsys Die Jungfrau von Orléans, die zugleich auch ihre letzte neue Bühnenrolle war.
An der Wiener Staatsoper konnte man die Freni in elf verschiedenen Partien erleben, wobei sie die Mimì mit 32 Vorstellungen am häufigsten sang. Frenis Staatsopernkarriere endete bereits im Juni 1995 mit drei Vorstellungen von Giordanos Fedora. Niemand hielt es damals für möglich, dass dies die letzten Auftritte dieses Wiener Publikumslieblings bleiben sollten.
Moderation: Thomas Dänemark
Veranstaltungsvorschau: Künstlergespräch mit Mirella Freni - Theater Akzent
Keine aktuellen Termine vorhanden!Das Reflektorium - Von Echnaton bis Mozart
Für die zweite Folge des „Reflektoriums“ wird der weltweit renommierte Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler Jan Assmann erwartet. Das Gespräch entwirft ein ungleichseitiges Dreieck mit den Eckpunkten Artaud, Echnaton und Mozart. Lässt sich das Ritual im Tempeldienst als Urform des Theaters der Grausamkeit erkennen, wenn man dies im Sinn Artauds als „innere Notwendigkeit“ und „Determinismus“ versteht? Gebiert Echnatons Revolution den Gottesdienst als Performance? Führt von Echnatons Monotheismus in dem Pan he Kai eine direkte Linie zur Freimaurerei von Mozart und zu Goethes FAUST? Über all dies wird nachgedacht und dabei wahrscheinlich auch die eine oder andere Hieroglyphe entziffert...
Jan Assmann lehrte als Professor in Heidelberg und im Rahmen verschiedener Gastdozenturen, u.a. auch als Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften Wien 2004. Veröffentlichungen u.a. „Monotheismus und die Sprache der Gewalt“ (Picus), „Ägyptische Religion. Totenliteratur“ (Insel) „Eine Sinngeschichte“ sowie „Die Zauberflöte. Oper und Mysterium“ (beide bei Hanser). Stefan Zweifel erhält im Oktober den „Berliner Preis der Literaturkritik 2009“.
Veranstaltungsvorschau: Das Reflektorium - Von Echnaton bis Mozart - Vestibül
Keine aktuellen Termine vorhanden!Europa im Diskurs 3: "The West and the Crisis" (in englischer Sprache)
Die amerikanische Politik während der Präsidentschaft von George W. Bush hat den Westen tief gespalten. Der Irakkrieg, aber auch die Ablehnung internationaler Abkommen zum Klimaschutz, wie das Kyoto-Protokoll, haben zu einem Bruch mit Europa geführt. Mit dem Amtsantritt Barack Obamas ist die Hoffnung auf eine Verbesserung der transatlantischen Beziehungen verbunden. Doch die Krise der globalen Finanzmärkte birgt ebenso Gefahren für die Weltgemeinschaft wie die unsichere Lage in Afghanistan und die unkalkulierbare Außenpolitik Russlands. Wie werden der Westen und insbesondere die Europäische Union damit umgehen?
Es diskutieren u.a. Radoslaw Sikorski, Aussenminister der Republik Polen, James Hoge, Herausgeber von Foreign Affairs, und Madeleine Albright, US-Aussenministerin unter Clinton (angefragt). Moderation: Gerfried Sperl, DER STANDARD.
Veranstaltungsvorschau: Europa im Diskurs 3: "The West and the Crisis" (in englischer Sprache) - Burgtheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Europa im Diskurs 2: "Where are Europe's Borders?" (in englischer Sprache)
Schon wo der Kontinent Europa endet, war historisch nie eindeutig, und das politische Europa hat selten mit seinen geographischen Grenzsetzungen übereingestimmt.
Teile der Karibik, Süd- und Nordamerikas, Inselgruppen im Pazifik, Atlantik und Indischen Ozean sowie die spanischen Enklaven in Nordafrika gehören als Erbe des Kolonialismus zu Europa. Die EU hat zwar von Beginn an klargestellt, dass ihr nur europäische Staaten beitreten können, aber unklar gelassen, welche Staaten als europäisch gelten können. Mit den Kopenhagener Kriterien werden die Grenzen Europas daher nicht mehr geografisch, sondern juristisch bestimmt: Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat und Marktwirtschaft - wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann Mitglied werden. Ist Europa damit am Ende grenzenlos?
Es diskutieren unter anderem die georgische Juristin und Politikerin Nino Burjanadze, die EU-Kommisarin Benita Ferrero-Waldner, der ehemalige polnische Staatspräsident Aleksander Kwasniewski und Cem Özdemir, Vorsitzender des Bündnis 90/die Grünen. Moderation: Alexandra Föderl-Schmid, DER STANDARD.
Veranstaltungsvorschau: Europa im Diskurs 2: "Where are Europe's Borders?" (in englischer Sprache) - Burgtheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!JosefStadtgespräch mit Eva Maria Marold und Viktor Gernot
Eva Maria Marold und Viktor Gernot sind mit Sicherheit das witzigste Trachtenpärchen, das es auf einer Bühne zu sehen gibt. Als Wirtin Josefa Vogelhuber und als Zahlkellner Leopold begeistern die beiden höchstmusikalischen Comedians gemeinsam mit einem umwerfenden Ensemble im „Weißen Rössl“ das Publikum der Kammerspiele.
Veranstaltungsvorschau: JosefStadtgespräch mit Eva Maria Marold und Viktor Gernot - Theater in der Josefstadt
Keine aktuellen Termine vorhanden!JosefStadtgespräch mit André Pohl und Alexander Pschill
In „Floh im Ohr“ reißen beide das Publikum zu Lachstürmen hin: Alexander Pschill mit einem glänzend gespielten Sprachfehler und artistischem Einsatz, André Pohl mit der subtil-rasanten Darstellung einer Doppelrolle, einmal als zurückhaltender Ehemann und dann als simpler Bordelldiener. Ob sie es genießen, dass das Publikum über sie lacht, ob Komiker wirklich traurige Menschen sind, wie eine populäre Fernsehserie das Leben verändern kann und wie es einem geht, wenn man für den Nestroy nominiert wird, erzählen die beiden Eva Maria Klinger.
Mit Unterstützung des Vereins der Freunde des Theaters in der Josefstadt.
Veranstaltungsvorschau: JosefStadtgespräch mit André Pohl und Alexander Pschill - Theater in der Josefstadt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Das rote Sofa im Weißen Salon
Veranstaltungsvorschau: Das rote Sofa im Weißen Salon - Volkstheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!denkBAR: Wie rechts ist Österreich?
Seit dem Kurz-Schluss des SPÖ-Parteivorsitzenden mit der Kronenzeitung, dem Ergebnis der Nationalratswahl, den Reaktionen des offiziellen Österreich auf Jörg Haiders Tod und einem Burschenschafter einer rechtsradikalen Studentendenverbindung als 3. Nationalratspräsidenten ist rundherum vom Rechtsruck die Rede. Das Ausland sieht das Klischee vom ewiggestrigen Naziland bestätigt.
Was steckt dahinter? Wie sehr werden die Ängste der Menschen übergangen oder missbraucht? Was ist faul im Staate? Ist die Entwicklung Österreichs eine Ausnahmeerscheinung, ein Ausfluss der österreichischen Geschichte und Seele oder Symptom der „Gruppe“ Europa?
Veranstaltungsvorschau: denkBAR: Wie rechts ist Österreich? - Volkstheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21










 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner