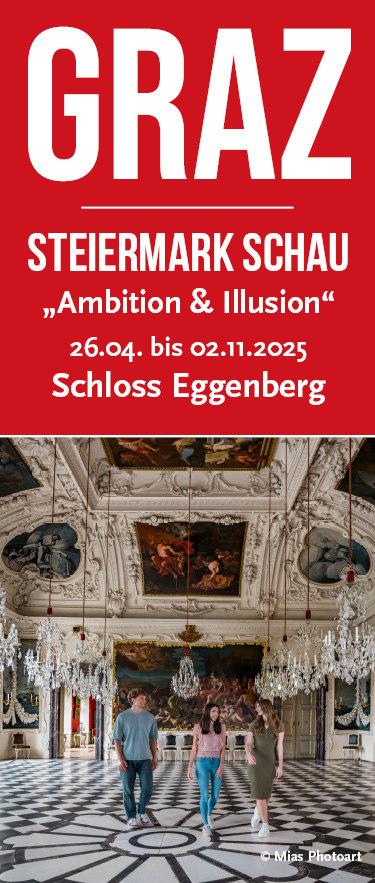Tickets und Infos Künstler der Galerie
Johannes Brus: Giving picture for trophy
Brus schafft monumentale Tableaus mit einer geradezu körperlichen Ausstrahlung, indem er die schwarz-weißen Fotovorlagen mit chemischen Verfahren verfremdet.
Der Ausstellungstitel bedeutet sowohl Geben eines Motivs als auch Ein Bild als Trophäe erstellen und Ein Bild als Trophäe ausstellen. Brus bearbeitet oft vorgefundene alte Fotos, darunter von Europäern aufgenommene Gruppenporträts indischer Maharadschas, aber auch Bilder klassischer Jagdtrophäen.
Diese Auseinandersetzungen mit dem Fremden, Wilden und Exotischen unterlaufen eine Domestizierung und hinterfragen zugleich Bedingungen und Möglichkeiten der künstlerischen Produktion und der Rezeption. Trophäen sind Zeichen des Sieges, die, als Prestigeobjekte mit neuer Bedeutung aufgeladen, zur Schau gestellt werden. Brus’ Arbeiten konfrontieren den Betrachter mit vertrauten Trophäen aufs Neue, diese erwachen zum Leben, entziehen sich und ergreifen Besitz von der Imagination des Betrachters.
Veranstaltungsvorschau: Johannes Brus: Giving picture for trophy - Museum Kunstpalast
Keine aktuellen Termine vorhanden!Eine Krone für die Stadt. Walter Gropius im Wettbewerb
Im Jahr 1927 schrieb die Stadt Halle einen bemerkenswerten Architekturwettbewerb aus: Auf dem Lehmanns-Felsen sollte als neues, signifikantes Zentrum der Stadt eine monumentale Stadtkrone mit Stadthalle, Konzerthalle, Museum und Sportanlagen entstehen. Die Idee ging zurück auf Bruno Taut, der entsprechende sozialutopische Visionen nach 1919, als sich eine Gruppe fortschrittlich gesinnter Architekten im „Arbeitsrat für Kunst“ zusammenschloss, entwickelte. Im Zentrum der Stadt wünschte er sich einen gläsernen Tempel der Gemeinschaft als neuen Mittelpunkt einer freien Gesellschaft. Im „roten Halle“ fanden diese Ideen früh ihren Widerhall. Mit dem Wettbewerb im Jahr 1927, den die Presse als „Akropolis von Halle“ betitelte, sollte diese Utopie gebaute Wirklichkeit werden.
An dem Wettbewerb beteiligten sich die bedeutendsten deutschen Architekten der Klassischen Moderne: Walter Gropius, Hans Poelzig, Peter Behrens, Emil Fahrenkamp, Paul Bonatz und Wilhelm Kreis. Auch reichten zahlreiche lokale Architekten und Künstler, darunter Paul Thiersch und Karl Völker, Entwürfe ein. Realisiert wurde keiner der Vorschläge und der Wettbewerb geriet über die Jahrzehnte vollständig in Vergessenheit. Es haben sich jedoch von den meisten Teilnehmern zahlreiche Originalpläne erhalten. Allein von Walter Gropius existieren noch 15 Entwürfe, von Peter Behrens wurden kürzlich sechs Originalentwürfe aufgefunden, die bislang als verloren galten, von Hans Poelzig sind 10 Originalzeichnungen vorhanden. Insgesamt werden in der Ausstellung 44 Originale und 8 Reprints sowie Architekturmodelle der wichtigsten Wettbewerbseingänge gezeigt, Arbeiten von Studierenden der BTU Cottbus für diese Ausstellung.
Sie wird begleitet von einem Katalog mit mehreren wissenschaftlichen Beiträgen. Im Rahmen der Ausstellung sollen diese einmaligen Architekturzeichnungen erstmals öffentlich präsentiert und analysiert werden. Im Mittelpunkt wird dabei der Entwurf „Hängende Gärten“ von Walter Gropius stehen, sowie die Planungen von Peter Behrens und Hans Poelzig. Im Kontext der anderen eingereichten Wettbewerbsbeiträge kann mit diesem Material ein weitgehend neuer Blick auf die hallesche Kultur- und Architekturpolitik geworfen werden.
Veranstaltungsvorschau: Eine Krone für die Stadt. Walter Gropius im Wettbewerb - Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Gerald Scarfe: "Tear down the Wall" - Werke für "Pink Floyd", Politische Karikaturen und satirische Porträts
Weltbekannt wurde Scarfes Arbeit vor allem durch seine Tätigkeit als Art Director für Pink Floyd auf dem epochalen Konzeptalbum „The Wall“ von 1978 -1979, dem daraus folgenden Film mit zahlreichen Animationssequenzen und den dazugehörigen Konzerten, für die er auch die Bühneneinrichtung entwarf.
Erstmals werden seine Zeichnungen und Animationen für das Konzert und den Film „The Wall" von Pink Floyd, die zwischen 1978 und 1991 entstanden sind, in Deutschland in einer eigenen Ausstellung gewürdigt.
Veranstaltungsvorschau: Gerald Scarfe: "Tear down the Wall" - Werke für "Pink Floyd", Politische Karikaturen und satirische Porträts - Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Denkmale für die Arbeit. Wirtschaftsgeschichte im Spiegel der Medaillenkunst
Die Form der Medaille spiegelt als handliches Erinnerungszeichen – vom anspruchsvollen Kunstwerk bis hin zum einfach gestalteten Souvenir – die wirtschaftliche Entwicklung und unternehmerisches Handeln vor allem im 19. und 20. Jahrhundert in besonderer Weise.
Die Medaillen verewigen die Entwicklung von Unternehmen, den Wandel des Bildes (des) vom Arbeiter(s) sowie vom (des) Unternehmer(s), ihrer Erfolge und Verdienste. Die Medaille ist damit eine künstlerische und wirtschaftshistorische Quelle. In einer Auswahl aus der Sammlung des Landesmünzkabinetts Sachsen-Anhalt präsentiert die Stiftung Moritzburg von … bis … signifikante Denkmale der Arbeitswelt aus unterschiedlichen Branchen. Zeugnisse der mitteldeutschen und halleschen Wirtschaftsgeschichte stehen im Mittelpunkt. Dazu gehören Preismedaillen von der halleschen Maschinenbaufirma F. Zimmermann, die erstmalig öffentlich gezeigt werden. Sie wurden auf den verschiedensten Messen in Europa errungenen und von der Tochter des Firmengründers bereits im Jahr 1894 dem Museum gestiftet.
Veranstaltungsvorschau: Denkmale für die Arbeit. Wirtschaftsgeschichte im Spiegel der Medaillenkunst - Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public": Verstaubt, Verschroben, oder doch von dieser Welt?
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Mag. Dominique Zimmermann.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public": Verstaubt, Verschroben, oder doch von dieser Welt? - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public": Lurche und Kriechtiere Wiens
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Dr. Heinz Grillitsch.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public": Lurche und Kriechtiere Wiens - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public": Die Schlangenfauna Nordafrikas
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Dr. Heinz Grillitsch.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public": Die Schlangenfauna Nordafrikas - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Annie Leibovitz - A Photographer's Life 1990-2005
"Annie Leibovitz: A Photographer’s Life 1990 – 2005" umfasst mehr als 150 Fotografien, davon viele großformatige Werke, sowie eine Anzahl von privaten Fotos. Zahlreiche Sequenzen beziehen sich auf ihre Eltern und zeigen Familientreffen und Reisen ans Meer. Und unvermittelt sieht man sich immer wieder mit Berühmtheiten konfrontiert, die Annie Leibovitz mit erstaunlicher Unmittelbarkeit porträtiert: Bill Clinton, Nelson Mandela, Demi Moore, Jack Nicholson, William Burroughs und viele andere. Die Werke von Leibovitz in dieser Ausstellung strahlen eine emotionale Kraft aus, die das bisherige Oeuvre der Fotografin in den Schatten stellt.
Annie Leibovitzs Foto-Ikonen, die das vielfältige Spektrum des amerikanischen Lebens und der populären Kultur bemerkenswert freimütig und kraftvoll einfangen, sind seit den 1970ern sowohl in Magazinen wie "Rolling Stone","Vanity Fair" und "Vogue" als auch in prominenten Werbekampagnen erschienen und in Kunstmuseen ausgestellt worden.
"Annie Leibovitz: A Photographer’s Life 1990-2005" ist eine Ausstellung des Brooklyn Museums, New York, kuratiert von Charlotta Kotik, emeritierte Kuratorin für zeitgenössische Kunst.
Bereits im Jahr 1993 fand unter dem Titel "Annie Leibovitz: Photographs 1970 – 1990", eine Ausstellung dieser herausragenden Künstlerin statt, die mit mehr als 80.000 Besuchern in nur 10 Wochen ein großer Erfolg war.
Fotos:
Annie Leibovitz
Brad Pitt, Las Vegas, 1994
Photograph © Annie Leibovitz
Courtesy of Vanity Fair
From Annie Leibovitz: A Photographerʼs Life, 1990 – 2005
Annie Leibovitz, Café de Flore, Paris, 1997
Photograph by Martin Schoeller
Veranstaltungsvorschau: Annie Leibovitz - A Photographer's Life 1990-2005 - KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser
Keine aktuellen Termine vorhanden!Art Brut aus Japan
Jeder der präsentierten Künstler, die am Rande der japanischen Gesellschaft und oft auch in psychiatrischen Einrichtungen leben, hat sich durch seine Kunst eine eigene Welt hoher ästhetischer Intensität erschaffen. Die Künstler werden mit ihrer Malerei und Grafik, ihren Skulpturen und Plastiken ebenso präsentiert wie durch berührende Dokumentarfilme, die ihre Schicksale, Lebensumstände und Arbeitsweise vermitteln. "Art Brut aus Japan" wurde von der Collection de l'Art Brut in Lausanne, dem international renommierten Museum für Art Brut entwickelt.
Veranstaltungsvorschau: Art Brut aus Japan - KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser
Keine aktuellen Termine vorhanden!Künstler der Galerie
Mit Richters ungewöhnlichen Bildern zeichnete sich schon nach kurzer Zeit Erfolg und ein breites Echo auf ihr Schaffen ab.
Ernst Fuchs zählt zu den Gründern der Wiener Schule des Phantastischen Realismus.
Gotthard Fellerer ist bildender und ausbildender Künstler, Publizist, Spurensucher sowie begeisterter Kunstmultiplikator.
Karl Goldammer beeindruckt u.a. mit seinen Häuserbildern.
Schwerpunkt in den Werken des Bildhauers Hans Muhr ist das Lebenselement Wasser.













 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner