Tickets und Infos Naturhistorisches Museum "Science Goes Public" - Mit einem Präparator durch die Schausammlung
Österreich-Ungarns Armee 1867 bis 1914
Direktor Dr. M. Christian Ortner führt durch den Franz Joseph-Saal.
Veranstaltungsvorschau: Österreich-Ungarns Armee 1867 bis 1914 - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!Österreichs Aufstieg zur Großmacht
Dr. Claudia Reichl-Ham führt durch das 17. und 18 Jahrhundert.
Veranstaltungsvorschau: Österreichs Aufstieg zur Großmacht - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!Menschen am Rand des Eises
In seiner jüngsten Sonderausstellung Menschen am Rand des Eises zeigt das Rosgartenmuseum Konstanz 15000 Jahre alte Werkzeuge, Waffen und Jagdgeräte. Sie stammen aus der späteiszeitlichen Höhle vom Kesslerloch bei Thayngen nahe der Schweizer Grenze.
Schon im ausgehenden 19. Jahrhundert war dem Reallehrer Konrad Merk und seinem Kollegen D. Wepf bei ihren Ausgrabungen im Kesslerloch und am Schweizersbild in der Gegend von Schaffhausen aufgefallen, dass die meisten Knochenfunde von Rentieren stammten. Deshalb wurde schon bald von Rentierjägern gesprochen.
Das Rentier ist eines der typischen Tiere der Arktis. Sein dichtes Winterfell schützt vor der Kälte, und mit seinen langen Beinen hat es genügend Bodenfreiheit, um sich auch bei tieferem Schnee fortzubewegen. Wegen seiner genügsamen Nahrungsansprüche hat es ein großes Verbreitungsgebiet von der Taiga bis weit hinauf in die baumlose Tundra. In der Eiszeit konnte es sein Areal immer wieder nach Mittel- und Westeuropa ausweiten und ist zeitweise bis zu den Pyrenäen vorgedrungen.
Für die Rangstellung der Tiere ist das Geweih von großer Bedeutung, ebenso für den Zugang zum Futter. Die männlichen Tiere besitzen größere Geweihe und imponieren damit während der Brunft. Die berühmt gewordene, besonders realitätsnahe Gravierung eines Rentiers auf dem Lochstab vom Kesslerloch wurde immer als „äsendes“ Rentier beschrieben. Seine naturalistische Körperhaltung entspricht aber wohl eher solch einer Imponierhaltung während der Brunft. Neben diesen herausragenden Objekten aus der archäologischen Sammlung des Rosgartenmuseums belegen vor allem die Werkzeuge und Jagdgeräte den Erfindungsreichtum der späteiszeitlichen Menschen, um in einer lebensfeindlichen Umwelt zu überleben.
Als die Menschen vor etwa 15000 Jahren die Höhle am Kesslerloch im schweizerischen Kanton Schaffhausen erstmals aufsuchten, war die Region bereits weitgehend eisfrei. Die Landschaft wurde von einer artenreichen Kräutervegetation geprägt, die am ehesten als Steppentundra bezeichnet werden kann. In Südwestdeutschland und in der Nordschweiz bot die Landschaft den Tieren zwischen Alpenrand und Schwäbischer Alb ideale Lebensbedingungen. Die meisten Fundstellen des Jungpaläolithikums sind bezeichnenderweise Höhlen oder Felsschutzdächer, sogenannte Abris, entlang der Südflanke der Alb und des Schweizer Jura. Wie das Kesslerloch boten sie einen natürlichen Schutz und eigneten sich hervorragend als Wohnplatz und Jagdlager.
Neuere Untersuchungen lieferten Hinweise auf ein Aufsuchen der Höhle bereits um 13300 vor Christus. Dafür sprechen auch die absolut kaltzeitlichen Faunenreste, die bei den Altgrabungen am Kesslerloch gefunden wurden. Rentier, wollhaariges Nashorn und Mammut sind durch Knochenreste belegt, Moschusochsen durch die figürliche Darstellung auf einem Geweihbruchstück.
Die Ausstellung im Rosgartenmuseum macht vertraut mit den Lebensbedingungen der Menschen, die vor 15000 Jahren als Jäger unsere Region am Rand des Eises durchstreiften, immer auf der Suche nach den großen Rentier- und Pferdeherden, die ihre wichtigste Jagdbeute und Nahrungsquelle waren.
25. Oktober 2008 bis 12. April 2009
Informationen
Rosgartenmuseum Konstanz
Rosgartenstraße 3–5
D-78462 Konstanz
Tel. (+49-75 31) 900-246
Di–Fr 10–18 Uhr, Sa, So und Fei 10–17 Uhr
www.konstanz.de
Moderne am Bodensee. Walter Kaesbach und sein Kreis
Auf Anraten des Malers Helmuth Macke zog sich Walter Kaesbach 1933 in die „innere Emigration“ auf die Bodenseehalbinsel Höri zurück. Er wurde dort aber nicht einfach zum Gärtner in idyllischer Landschaft. Von Hemmenhofen aus, wo bald auch Otto Dix lebte, hielt er Kontakt zu den als „entartet“ gebrandmarkten Künstlern, allen voran zu seinen langjährigen Freunden Christian Rohlfs, Heinrich Nauen und Erich Heckel. Gefördert und gesammelt hatte er die Expressionisten schon, als er Assistent von Ludwig Justi an den Museen in Berlin war, dann als Leiter des Erfurter Museums und schließlich in Düsseldorf. Seine umfangreiche private Kunstsammlung stiftete er noch in den 1920er-Jahren seiner Heimatstadt, Mönchengladbach.
Von 1933 bis 1947 scharte Walter Kaesbach auf der Höri zahlreiche Künstler um sich, darunter nicht wenige Maler aus dem Rheinland: Erich Heckel, Curth Georg Becker, Ferdinand Macketanz, Hans Kindermann, Walter Herzger, Jean Paul Schmitz und Rudolf Stuckert. Andere wie Heinrich Nauen, Werner Gilles, William Staube oder Hein Minkenberg besuchten ihn.
Nach dem Untergang der Hitlerdiktatur profitierte die Region von den weit gespannten Kontakten dieses Mentors der Moderne. Bereits im Herbst 1945 organisierte er zusammen mit dem Maler Werner Gothein die wegweisende Schau Deutsche Kunst unserer Zeit in Überlingen. 1946 wirkte er an den nicht weniger bedeutenden Konstanzer Kunstwochen mit. Den von Malerei faszinierten Obstbauern Paul Weber beriet er beim Aufbau einer hochkarätigen Sammlung zeitgenössischer Kunst. Bis an sein Lebensende war Kaesbach ein gefragter Sachverständiger für Museumsleute und Kunsthistoriker.
Mit rund 80 hochkarätigen Exponaten und zahlreichen Originaldokumenten zeichnet die Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz Kaesbachs Engagement als Mentor der Moderne nach. Einbezogen werden Kaesbachs Künstlerfreundschaften und seine Sammlungstätigkeit vor 1933, sodass der Besucher Einblick in die Zeit des Aufbruchs und der Verfolgung deutscher Avantgardekunst im 20. Jahrhundert gewinnt.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog (120 Seiten, 95 Abbildungen) zum Preis von 15 Euro, der den neuesten Stand der Forschung zu Kaesbachs Wirken – nicht nur am Bodensee – zusammenfasst.
Informationen
Moderne am Bodensee. Walter Kaesbach und sein Kreis
bis 11. Januar 2009
Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz
im Kulturzentrum am Münster
Wessenbergstraße 43, D-78462 Konstanz
Tel. (+49-75 31) 900-921 oder -376 (Verwaltung)
Di–Fr 10–18 Uhr, Sa, So und Fei 10–17 Uhr;
Mo sowie am 24., 25. und 31. Dezember 2008 sowie am 1. Januar 2009 geschlossen
[email protected]
www.konstanz.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Staatsgala – Fotografien von Lothar-Günther Buchheim
Diese "Fotos ohne Pose" machen den Betrachter zum Augenzeugen eines singulären Ereignisses: Die Bonner Szene formiert sich 1977 zum prangenden Staatsempfang für das spanische Königspaar. Lothar-Günther Buchheim dringt mit seiner Kamera in Bezirke, die Fotografen und Presseleuten verschlossen bleiben. Als Tarnung und Arbeitskleidung dient ihm - wie einst seinem Vorbild, dem unvergessenen Bild-Journalisten Salomon - der vom Protokoll vorgeschriebene Frack. Den steten Wechsel aufregender Schwarzweißkompositionen in seinem Sucher verwandelt der "Bilderbauer" Buchheim auf dem Film zu unvergleichlichen Fotografien: Der Staat, der sich selbst darstellt - die Verdienten der Nation aller Couleur figurieren als Statisten. Die Bilder dokumentieren jede Phase des festlichen Geschehens und verleihen nicht nur den spontanen Gesten der Akteure Dauer, sondern bewahren auch das besondere Fluidum des Augenblicks. Der narrative Text, mit dem Buchheim seine stupefierenden Aufnahmen gleichsam kontrapunktisch begleitet, trägt dieselbe unverwechselbare Handschrift wie die Fotografien und das Layout.
Veranstaltungsvorschau: Staatsgala – Fotografien von Lothar-Günther Buchheim - Buchheim Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Wunderland Waldviertel
Eindrucksvolle multimediale Raumszenarien mit großen und kleinen Objekten und Skulpturen, mit Bildern und Bildwänden, mit Licht- und Toneffekten, öffnen den Blick für die faszinierenden Geheimnisse des Waldes, der Teiche und der großen Steine.
Zusammen mit Werken nationaler und internationaler Künstler, inszeniert der Ausstellungsgestalter Prof. Makis Warlamis ein "künstlerisch - poetisches" Waldviertel.
Veranstaltungsvorschau: Wunderland Waldviertel - Das Kunstmuseum Waldviertel
Keine aktuellen Termine vorhanden!Otto IV. – das Kaiserjahr 2009 zur Niedersächsischen Landesausstellung
Im Mittelpunkt steht die Niedersächsische Landesausstellung Otto IV. – Traum vom welfischen Kaisertum (8. August bis 8. November 2009) des Braunschweigischen Landesmuseums unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Ministerpräsidenten, Christian Wulff. Mehr als 200 eindrucksvolle Exponate aus internationalen Museen, Bibliotheken und Sammlungen spiegeln ein facettenreiches Bild Ottos IV. und seiner Zeit wider. Die Ausstellung zum 800. Krönungsjubiläum an einem zentralen Ort seines Lebens, dem Braunschweiger Burgplatz mit dem Dom Sankt Blasii und der Burg Dankwarderode, stellt den Welfenherrscher erstmals einer breiten Öffentlichkeit vor.
Mit einem umfangreichen Erlebnisprogramm von Mai bis November lässt Braunschweig das Mittelalter wieder lebendig werden. Das historische Pfingstfest Kaiser Ottos, der Hoftag von 1209, vom 30. Mai bis 1. Juni eröffnet offiziell das „Kaiserjahr“. Der Burgplatz wird zur Bühne, auf der höfische Rituale wie die Schwertleite oder die Tafelrunde inszeniert werden.
Ab Juni lädt der neu konzipierte Mittelalterweg zur Spurensuche in die mittelalterliche Löwenstadt ein. Bei besonderen Stadtführungen werden in den jahrhundertealten Kemenaten Geschichten aus vergangener Zeit erzählt. Höhepunkte sind authentische Konzerte mit mittelalterlicher Musik aus der Wienhäuser-Liederhandschrift, einem der ältesten deutschen Liederbücher (zirka 1470).
Individualtouristen können sich ganzjährig von Kaiser Ottos Truchsess, Gunzelin von Wolfenbüttel, durch die mittelalterliche Welfenstadt mit einer Audioguide-Führung (spezielles Hörspiel) begleiten lassen (Deutsch/Englisch). Beim großen Braunschweiger Ritterturnier mit über 300 Akteuren am 12. und 13. September mit Heerlager und mittelalterlichem Markt können Besucher das Mittelalter hautnah erleben. Am 17. und 18. Oktober rufen die mittelalterlichen Sänger beim Europäischen Minnesang-Festival „Her keiser, sit ir willekommen“ zum Wettstreit auf. Nationale und internationale Künstler tragen in mittelalterlicher Sprache und in beeindruckender historischer Kulisse im Altstadtrathaus, im Dom Sankt Blasii und in der Martinikirche ihre Lieder vor und streiten um den Ruhm des Besten. Auch der bekannte Tenor John Potter (England) hat zugesagt. Zum 800. Jahrestag der Kaiserkrönung am 4. Oktober bieten das Landesmuseum und der Dom ein feierliches Programm an. Unter anderem führt das Staatsorchester Braunschweig die Oper Riccardo I. von Georg Friedrich Händel im Dom Sankt Blasii auf.
Reisepakete und besondere Stadtführungen bieten maßgeschneiderte Programme für einen Besuch in der traditionsreichen Welfen- und Hansestadt.
Touristinfo, Braunschweig Stadtmarketing GmbH
Vor der Burg 1, D-38100 Braunschweig
Tel. (+49-531) 470 20 40
[email protected]
www.braunschweig.de/otto
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
"Science Goes Public" - Das Haus der Wunder. Ein Streifzug durch das schönste Museum der Welt
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Dr. Manfred Jäch.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public" - Das Haus der Wunder. Ein Streifzug durch das schönste Museum der Welt - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public" - Hinter die Kulissen der botanischen Abteilung
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Dr. Bruno Wallnöfer.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public" - Hinter die Kulissen der botanischen Abteilung - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public" - Mit einem Präparator durch die Schausammlung
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Robert Illek.









 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner 






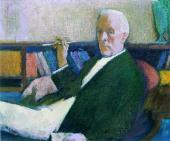









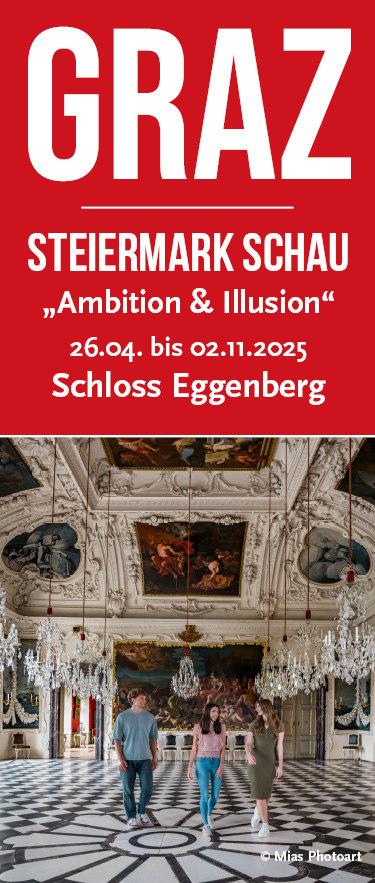







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.