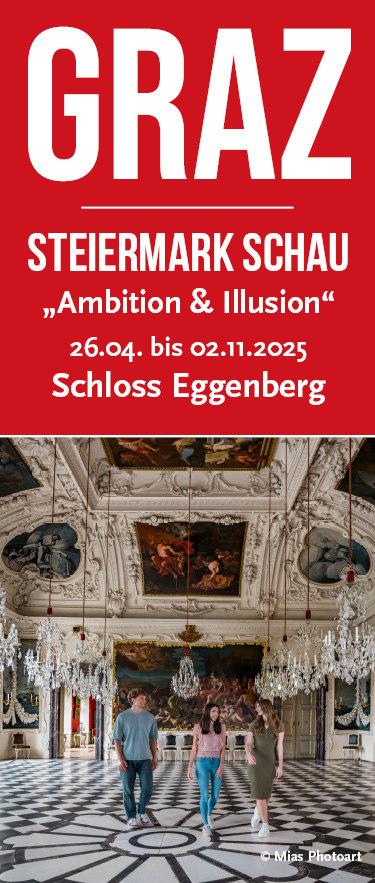Tickets und Infos Karikaturmuseum Krems Das ist Deix: Dauerpräsentation
Themenführung: "Staatsbankette einst und jetzt"
Viele Ausstellungsstücke verloren mit dem Ende der Monarchie ihre ursprüngliche Bestimmung. Andere wiederum fanden weiterhin Verwendung. Sie dienten von nun an der Repräsentation der Republik bei Staatsbanketten und großen Galadiners. So finden sich bis zum heutigen Tag im Bestand der Silberkammer Objekte, die nach wie vor in Gebrauch sind.
Lassen Sie sich entführen in längst vergangene Zeiten! Erzählt wird, wie ein kaiserliches Staatsdiner ablief, was heute zu einem Staatsbankett dazu gehört und gelächelt werden kann über so manche Anekdote!
Veranstaltungsvorschau: Themenführung: "Staatsbankette einst und jetzt" - Hofburg - Silberkammer, Sisi Museum, Kaiserappartements
Keine aktuellen Termine vorhanden!Ich bin ganz wo anders - Jam krejt dikund tjetër [itc]
In Österreich leben mehr als 50.000 Kosovaren. Viele von ihnen haben einen Teil der Familie, Freunde oder Arbeitspartner, familiäre, soziale und ökonomische Bindungen im Kosovo. Auf der Basis von Gesprächen und wechselseitigen Besuchen in Peja (Kosovo), Wien und Linz entwickeln Künstlerinnen und Künstler der drei österreichischen Kunstuniversitäten Arbeiten, die sich exemplarisch mit Themen des Ortes und der Identität auseinandersetzen.
Wiener Festwochen
Veranstaltungsvorschau: Ich bin ganz wo anders - Jam krejt dikund tjetër [itc] - Österreichisches Museum für Volkskunde
Keine aktuellen Termine vorhanden!Schloss Esterhazy: Phänomen Haydn - prachtliebend
Die Ausstellung umfasst dabei Haydns Arbeiten zur fürstlichen Repräsentation im Schloss Esterházy, sein privates Leben und Komponieren im Haydnhaus, die Frömmigkeit jener Zeit sowie das geistliche Werk Haydns im Diözesanmuseum Eisenstadt und die ihn umgebende Dörfliche Lebenswelt im Landesmuseum Burgenland. Gezeigt werden wertvollste Kunstwerke, kostbare Autographe und originale Musikinstrumente von namhaften Leihgebern aus ganz Europa. Konzeption, Dramaturgie und Ausstellungsgestaltung haben sich dem Anspruch gestellt, Original und Originalschauplätze, Exponate und authentische Orte in adäquater Weise zu verbinden: Noch nie konnten so viele Ausstellungsstücke an ihren originalen Wirkungsstätten gezeigt werden.
Überdies werden im zuge eines gemeinsamen Ausstellungsverbundes von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unter dem Titel „Echt Haydn“ alle originalen Wirkungsstätten Haydns präsentiert. Es besteht daher erstmalig die einmalige Möglichkeit, das Genie Joseph Haydn und die besondere Aura seiner Wirkungsstätten zu sehen, zu hören und zu erleben.
Schloss Esterházy: Brennpunkt höfischer Musikkultur
Als Joseph Haydn seinen Dienst als „Capell-Meister“ antritt, ist das Schloss Esterházy in Eisenstadt Hauptresidenz einer der reichsten und mächtigsten Fürstenfamilien Ungarns. Es ist ein Ort, der unter der Herrschaft seiner kunstsinnigen Magnaten zum Brennpunkt höfischer Musikkultur werden sollte. Haydns Musikschaffen ist glanzvoller Teil der fürstlichen Repräsentation und umfasst Symphonien, Opern und kammermusikalische Werke. Die Ausstellung erlaubt mit dem Anstellungsvertrag und einem eigenhändig verfassten Werkverzeichnis des Komponisten einen ersten, ungewöhnlichen Blick hinter die Kulissen. Damit wird der schwierige Eintritt in die höfische Welt der Fürsten Esterházy genauso begreifbar wie das ungeheure Arbeitspensum des Künstlers. Tatsächlich hat dieser eine wahre „Haydn-Arbeit“ zu bewältigen.
Nach diesem Einblick in die Hintergründe des Schaffens können die BesucherInnen die Bühne der glanzvoll-höfischen Musik betreten. Der Bogen der ausgestellten Kompositionen erstreckt sich von Haydns erster Symphonie bis zu seinem vielleicht bekanntesten Werk, dem „Kaiserquartett“. Dieses erlebte im Schloss Esterházy seine Uraufführung. Mit erlesenen Gemälden und kostbaren Objekten aus der Schatzkammer wird die fürstliche Sammelleidenschaft eindrucksvoll inszeniert. Die Musikeinspielung eines der Hauptwerke aus Haydns Spätzeit, des Oratoriums „Die Schöpfung“, bildet den ergreifenden Höhepunkt im weltberühmten Haydnsaal.
Veranstaltungsvorschau: Schloss Esterhazy: Phänomen Haydn - prachtliebend - Schloss Esterházy
Keine aktuellen Termine vorhanden!NHM Über den Dächern Wiens
Ein kulturhistorischer Spaziergang durch das Museum bis auf die Dachterrasse mit fantastischem Wienblick wird zum unvergesslichen Erlebnis.
Jeden Mittwoch, 18:30 Uhr deutsch
Jeden Sonntag, 15:00 Uhr englisch, 16:00 Uhr deutsch
Führungskarte: 6,50 Euro
Keine Anmeldung erforderlich.
Ab 12 Jahren!
Veranstaltungsvorschau: NHM Über den Dächern Wiens - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Tierisch komisch! Das Animalische in der Karikatur
Das Karikaturmuseum Krems widmet sich in einer großangelegten Schau erstmals dem Tier in der zeitgenössischen humoristischen Zeichnung und Bildsatire: einerseits als Stellvertreter für menschliches Gebaren, bei dem keine Gegenwehr zu befürchten ist, andererseits als bester Freund des Menschen. Haustier und Nutzvieh, das heilige und das eklige, das gejagte und das behütete Tier, und nicht zuletzt das Animalische im Menschen finden in dieser Ausstellung ihren Platz.
Mehr als sechzig nationale und internationale Künstler von Loriot über Robert Gernhardt, Erich Sokol, Gerhard Haderer, Ronald Searle, Margit Krammer, Manfred Deix, Rudi Hurzlmeier, Ernst Kahl, Tomi Ungerer bis Otto Waalkes zeigen ihr Verhältnis zum Tier und ihren Umgang damit.
Veranstaltungsvorschau: Tierisch komisch! Das Animalische in der Karikatur - Karikaturmuseum Krems
Keine aktuellen Termine vorhanden!60 Jahre – Unimog und Landwirtschaft
Im August 1948 wurde der Unimog von der Firma Boehringer, Göppingen, als Universal-Motor-Gerät mit Front- und Heckanbaugeräten auf der DLG-Ausstellung vorgestellt. Die Resonanz auf dieses Fahrzeug war außergewöhnlich positiv, obwohl er als erste Neuentwicklung eines Traktors nach dem 2. Weltkrieg völlig anders aussah, als ein normaler für die Land- und Forstwirtschaft entwickelter Traktor: Rahmenbauweise, gefederte Achsen, Allradantrieb, gleichgroße Räder, Fahrerhaus für 2 Personen, eine Hilfsladefläche, 3 An- und Aufbauräume, Höchstgeschwindigkeit von über 50 km/h etc. Inzwischen sind gut 60 Jahre vergangen, Anlass genug für eine Sonderausstellung zum Thema Landwirtschaft im Unimog-Museum.
Gezeigt werden eine größere Anzahl von Unimog, vom Prototyp Nr. 6 (1948) bis hin zu dem jüngsten Produkt innerhalb der Mercedes-Benz Unimog-Baureihen, dem Unimog U 20 (2008).
Die Vielfalt der Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten des Unimog werden eindrucksvoll präsentiert durch das Zusammenspiel von Unimog und Geräten aus der Anfangszeit bis hin zur modernen Landtechnik.
Gezeigt wird ferner ein Vergleich zwischen einem Standard-Traktor und dem Unimog sowie eine Kartoffellegemaschine, die unter wissenschaftlicher Begleitung an der FH Berlin, Bereich Technik und Wissenschaft, von Stefanie Gehrmann restauriert wurde.
Abgerundet wird das Schwerpunktthema durch eine Diorama-Ausstellung von Toon Versnick aus Belgien sowie einer Foto-Ausstellung mit historischen Bildern des Agrarjournalisten Wolfgang Schiffer in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsverlag.
Programm-Höhepunkte:
26. April: Eröffnung der Sonderausstellung mit Vorträgen, Führungen und Präsentation von ferngesteuerten Unimog,
13. Juni: Langer Museumsabend bis 20 Uhr anlässlich des Kurparkfestes „Licht-Kunst-Lauf“ im benachbarten Kurpark,
11. Oktober: Bauern- und Kunsthandwerkermarkt im Unimog-Museum,
24. und 25. Oktober: 2. MBtrac-Treffen im und am Museum mit buntem Rahmenprogramm.
Veranstaltungsvorschau: 60 Jahre – Unimog und Landwirtschaft - Unimog-Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Schöne Madonnen am Rhein
In der Geschichte des Marienbildes bilden die Jahrzehnte vor und um 1400 einen Höhepunkt. Kaum je zuvor oder danach gelang den Künstlern - allen voran den Bildhauern - eine so vollkommene Verbindung von irdischer und überirdischer Schönheit, Idealität und Wirklichkeitsstudium, theologisch gehaltvoller Aussage und menschlicher Nähe. Die zeitgenössische Frömmigkeitshaltung fand damals Ausdruck vor allem in Einzelstatuen der Muttergottes mit dem Kind und den Pietà-Gruppen, d.h. den Bildwerken der Schmerzensmutter unter dem Kreuz mit dem toten Sohn im Schoß. Die Ausstellung will die bisher nicht genügend gewürdigte und zum Teil falsch eingeordnete Kerngruppe der Rheinischen Marienstatuen um 1400 zusammenstellen und zu ihrer Neubewertung beitragen. Sie wird zeigen, dass sich in diesen Werken die damalige politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen des Rheinlandes abzeichnen und dass ihre Eigenart nur verstanden werden kann, wenn man den historischen Zusammenhang berücksichtigt.
Veranstaltungsvorschau: Schöne Madonnen am Rhein - LVR-LandesMuseum Bonn
Keine aktuellen Termine vorhanden!Wege des Wissens: Mauersegler im Anflug
Von Mai bis Juli bevölkern die Mauersegler Wien. Sie erobern den Luftraum über der Stadt und brüten im Dachbereich von Wohnhäusern, Türmen, Fabriken oder an Brücken. Auch in den beiden Innenhöfen des Naturhistorischen Museums haben einige Mauerseglerpaare ihre Bruthöhlen. Anita Gamauf, Wissenschafterin in der Vogelsammlung des Museums, stellt diesen faszinierenden Vogel und seine Lebensweise vor. Gemeinsam mit Fachleuten von BirdLife begeben sich die BesucherInnen anschließend aufs Dach des Museums, beobachten die Mauersegler der Innenstadt und führen eine Zählung durch.
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung unter +43 1 52177-335, Agnes Mair, Gertrude Schaller.
Veranstaltungsvorschau: Wege des Wissens: Mauersegler im Anflug - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Wildwechsel Wien
Wien hat mehr zu bieten als Konzerte, Museen und Großstadtrummel. In Parks, entlang von Flüssen, in den Randbezirken und sogar mitten in den Innenbezirken bietet die Stadt Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Die Haubenlerche bewohnt freie Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten. Der Mauersegler – ursprünglich ein Felsbrüter – nutzt in den Großstädten Hohlräume hoher Gebäude. Der Gartenrotschwanz bevorzugt dagegen Parks und Villenviertel. Auch Fuchs und Dachs werden immer mehr zu Städtern und bedienen sich am reichen Nahrungsangebot. Nachts gehen Fledermäuse auf Insektenjagd.
Vom Rotfuchs bis zur Wiener Schnirkelschnecke spannt sich der Bogen der Wiener Tierwelt, die im Naturhistorischen Museum Wien in den Mittelpunkt gestellt wird. Infofahnen im Schaubereich kennzeichnen die Orte des Wildwechsels.
Information: Museumspädagogik, Naturhistorisches Museum Wien
+43 1 52177-335 (Montag 14 bis 17 Uhr, Mittwoch bis Freitag 9 bis 12 Uhr), [email protected], [email protected].
Veranstaltungsvorschau: Wildwechsel Wien - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Das ist Deix: Dauerpräsentation
Neben aktuellen Cartoons ist erstmals unbekanntes und unveröffentlichtes Material des Großmeisters der österreichischen Karikatur zu sehen: frühe Schülerzeitungen, erste Comics für die St. Pöltner Kirchenzeitung, Arbeiten aus der Studienzeit und mehr. Deix' Anfänge als Cartoonist in den frühen 70er Jahren, anschließende öffentliche Aufträge, seine Tätigkeit als Dichter und seine Fernseh- und Buchproduktionen finden breiten Raum. Anhand von Fotos, Briefen, Skizzenmaterial und den legendären 'Deix-Faxen' wird auch seiner Tierliebe und seiner Begeisterung für die Beach-Boys nachgegangen. Darüber hinaus kommen persönliche Freunde und Weggefährten zu Wort.
Der Titel der Schau "Das ist Deix" ist programmatisch! Sie zeichnet mit vielen neuen, überraschenden und bisher unbekannten Werken die Entwicklung vom 'enfant terrible' der satirischen Zeichnerszene Österreichs der 70er Jahre bis zum Markenzeichen 'Deix' nach.










 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner