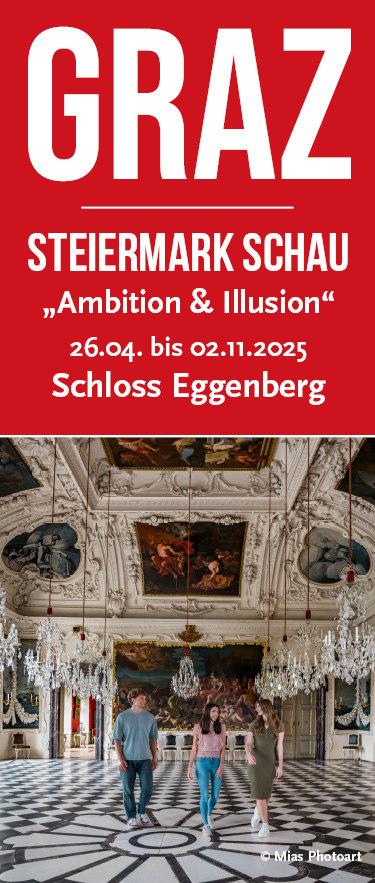Tickets und Infos Hofburg - Silberkammer, Sisi Museum, Kaiserappartements Themenführung: "Sisi und ihre Familie"
Tracey Emin. 20 Years
1999 wurde Tracey Emin für den Turner Prize nominiert, den sie mit der skandalösen Arbeit My Bed (1998) zwar nicht errang, dafür aber vom Sammler Charles Saatchi sowie einem grösseren Fernsehpublikum entdeckt wurde. Ihr offizieller Länderbeitrag für Grossbritannien an der Biennale Venedig 2007 gab letztes Jahr Gelegenheit, aktuelle und ältere Werke in Gegenüberstellung zu erleben und durch den Dunst von Glamour und persönlicher Tragik, welche den Star Tracey Emin umgeben, hindurchzuschauen.
Die Scottish National Gallery of Modern Art hat die erste Retrospektive der Künstlerin zusammengestellt, welche im Kunstmuseum Bern als Emins erste Einzelausstellung in der Schweiz gezeigt wird.
Veranstaltungsvorschau: Tracey Emin. 20 Years - Kunstmuseum Bern
Keine aktuellen Termine vorhanden!Im Kabinett: Bethan Huws – Aquarelle
Die meisten Darstellungen haben zwar einen biographischen Bezug – sie nähren sich aus Erinnerungen der Künstlerin, an die Heimat, an Dinge und Personen, die ihr nahestehen –, weisen aber in ihrer Reduktion weit über sich hinaus.
Die Ausstellung im Graphischen Kabinett präsentiert eine Auswahl der Aquarelle aus den Jahren 1988 bis 1997, die anlässlich der im Kunstmuseum Bern gezeigten Einzelausstellung Bethan Huws – Watercolors im Frühjahr 1999 angekauft worden sind.
Veranstaltungsvorschau: Im Kabinett: Bethan Huws – Aquarelle - Kunstmuseum Bern
Keine aktuellen Termine vorhanden!Prinzhorn Collection
Hans Prinzhorn (1886-1933), als Kunsthistoriker und Arzt mit beiden Fachgebieten vertraut, gilt heute als Pionier einer interdisziplinären Sichtweise. Ihn interessierten kulturanthropologische Fragen, etwa nach dem Ursprung künstlerischer Gestaltung oder dem "schizophrenen Weltgefühl" in der expressionistischen Kunst seiner Zeit, und er hoffte, in den Werken der Patienten einen unverstellten, elementaren Zugang zur Kunst zu finden.
In den Nachkriegsjahren des ersten Weltkriegs baute er, von Karl Wilmanns, dem Leiter der Heidelberger Psychiatrischen Klinik, unterstützt, eine einzigartige Sammlung von Werken aus psychiatrischen Anstalten auf. Mit seinem reich illustrierten Buch Bildnerei der Geisteskranken (Berlin 1922), in dem große Teile der Sammlung dokumentiert, interpretiert und in kulturkritische Überlegungen eingebettet werden, verabschiedet er endgültig die Frage nach einer diagnostischen Beweiskraft. Indem er die psychologische Gleichwertigkeit aller gestalterischen Phänomene betont und bestimmten Werken künstlerische Qualität zuerkennt, bewertet er die verachtete "Irrenkunst" und damit auch ihre Schöpfer neu.
In dieser Öffnung einer fachspezifisch eingeengten, psychiatrischen Sichtweise in kunstwissenschaftliche und künstlerische Bereiche hinein ist die besondere Leistung Prinzhorns zu sehen. Es war ein mutiger Schritt, der - langfristig gesehen - dazu beitrug, über eine angemessene Anerkennung kreativer gestalterischer Leistungen der Patienten ihre gesellschaftliche Reintegration zu fördern.
Künstler wie Alfred Kubin, Paul Klee, Max Ernst oder Pablo Picasso ließen sich von den Patientenwerken faszinieren und inspirieren. Psychopathologisch eingeweihte Künstler (Gorsen) wurden auch nach dem zweiten Weltkrieg zu wichtigen Transformatoren dieser Werke. Zusammen mit weiteren Entdeckungen von Anstalts- und Außenseiterkunst, von Dubuffet in den fünfziger Jahren zu Art Brut erklärt, geben sie bis heute wichtige ästhetische Impulse. Inzwischen hat auch die Psychiatrie weitgehend ihre Einstellung geändert. Es wird wieder gesammelt, doch jetzt unter ästhetischen Gesichtspunkten. Künstlerische Therapien haben sich in der modernen Psychiatrie etabliert.
Die Sammlung vereint Zeichnungen, Gemälde, Collagen, Textilien, Skulpturen und eine Fülle unterschiedlicher Texte, die zwischen 1880 und 1920 in psychiatrischen Anstalten vorwiegend des deutschsprachigen Raums entstanden sind. Die meisten der oft langjährig internierten Patienten galten als schizophren. Die Werke spiegeln unterschiedliche soziale Herkunft und Bildung ihrer Autoren. In ihnen zeigt sich, oft in fragmentierter oder verfremdeter Form, Zeitgeschichte und ihre Ideologien, aber auch das individuelle Leben vor der Erkrankung sowie die deformierende Anstaltsinternierung.
Veranstaltungsvorschau: Prinzhorn Collection - Stift Admont
Keine aktuellen Termine vorhanden!Themenführung: "Möbel von Otto Wagner, Josef Hoffmann und Adolf Loos"
Der Grandseigneur Otto Wagner, der Sezessionist Josef Hoffmann und der Außenseiter Adolf Loos sind mit Möbeln im Hofmobiliendepot vertreten. Die berühmte Sitzmaschine, Mobiliar aus der k.& k. Hof- und Staatsdruckerei und aus dem Café Museum (auch Café Nihilismus genannt) oder die einzigen je von A. Loos signierten Möbel sind Eckpunkte dieser Spezialführung.
Veranstaltungsvorschau: Themenführung: "Möbel von Otto Wagner, Josef Hoffmann und Adolf Loos" - Hofmobiliendepot. Möbel Museum Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Themenführung: Alltag im Biedermeier
Der bürgerliche Wohnstil wird zwar oft als brav und bieder abgestempelt, tatsächlich war er mutig und progressiv.
Ergründen Sie mit Herbert Steinwender die gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründe dieser spannenden Zeit! Hauptaugenmerk bei dieser Führung wird auf das Thema "Wohnen" gelegt:
Wie stand es um den Wohnkomfort?
Wie heizte man?
Wie ging man mit Licht um?
Wie waren die Möbel konzipiert?
Erleben Sie anhand von 15 Biedermeierkojen diese interessante und vielseitige Zeit.
Veranstaltungsvorschau: Themenführung: Alltag im Biedermeier - Hofmobiliendepot. Möbel Museum Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Themenführung: Kaiser Franz - zwischen Metternich und Napoleon
Kaiser Franz ging als der letzte römisch-deutsche Kaiser (Franz II.) und erste österreichische Kaiser (Franz I.) in die Geschichte ein. Daher stammt die ungewöhnliche Bezeichnung Franz II./I.
Er ist einer der widersprüchlichsten Habsburger, mit dem wir heute vor allem das Biedermeier mit dem aufkommenden Bürgertum assoziieren. Fälschlich oft als eher unbedeutend eingestuft, hatte er doch maßgeblich Anteil an den großen Ereignissen und Entwicklungen seiner Zeit.
Dennoch überschatteten genau diese Ereignisse und deren zentrale Akteure - Napoleon und Metternich - die wahre Bedeutung dieses letzten Kaisers des Heiligen Römischen Reiches.
Anhand seiner Mobilien und persönlichen Gegenständen wird sich bei dieser Führung dem ersten österreichischen Kaiser angenähert. Es werden biographische und politische Entwicklungen zusammengeführt und die ausgestellten Stücke mit dem Leben und Wirken ihres Besitzers in Verbindung bringen.
Veranstaltungsvorschau: Themenführung: Kaiser Franz - zwischen Metternich und Napoleon - Hofmobiliendepot. Möbel Museum Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Jean Prouvé. Die Poetik des technischen Objekts.
Mit dieser Ausstellung - in Kooperation mit dem Vitra Design Museum aus Deutschland - setzt das Hofmobiliendepot seine Ausstellungsserie der großen Designerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts fort.
Jean Prouvé vermag uns zu inspirieren als jemand, der Kreativität, Unternehmertum und Arbeitsethik mit großem Erfolg zu verbinden wusste. Er verknüpfte Handwerk mit Industrie und Design mit Architektur, und mit jedem Schritt trug er die Summe seiner Erfahrungen weiter - als Kunstschmied des Art déco, als Fabrikant und Kontrukteur von Möbeln und Architektur und schließlich als hochgeschätzter Lehrer. Dabei suchte er nie nach der eigenen Handschrift, sondern immer nach logischen Antworten auf die gewünschten Funktionen und die verfügbaren Mittel. Gerade daraus erklärt sich der authentische, unverwechselbare Ausdruck seiner Arbeiten.
Jean Prouvé ist eine zentrale Figur im Design des 20. Jahrhunderts. Er wird heute als einer der innovativsten Konstrukteure in Architektur und Möbelbau geschätzt. Demontierbare Leichtbauten - von kleinen Baracken bis zu großen Hallen - multifunktinale Fassadensysteme sowie verstell- oder zerlegbare, extrem solide Möbel entwickelte er konsequent aus seinen produktionstechnischen Kenntnissen heraus. Mit der wachsenden Technikbegeisterung der letzten Jahre traten Prouvés einflussreiche Erfindungen von Gebäudekonstruktionen und die schlichten industriellen Funktionsmöbel erneut ins Bewusstsein und erlebten hohe Wertsteigerung.
Gezeigt werden die wichtigsten Originalmöbel, viele originale Architekturelemente sowie zahlreiche Architekturmodelle, Fotografien und Originalzeichnungen zu Architektur und Möbeln. Ziel der Ausstellung ist es, Prouvés Werk von möglichst vielen Blickwinkeln aus zu beleuchten und seine beispiellose Vielseitigkeit und Virtuosität für die Besucher und Besucherinnen erfahrbar zu machen.
Veranstaltungsvorschau: Jean Prouvé. Die Poetik des technischen Objekts. - Hofmobiliendepot. Möbel Museum Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Rainer WÖLZL - Museum der Schatten
"Das Verstummen, die Lähmung derer, deren Los es war, in die Erde gestampft zu werden" sei "weiterhin spürbar", zitiert Wölzl Peter Weiss und versucht zugleich, mit einer "Malerei des Verschwindens" dieses Verstummen in doppeltem Sinn aufzuheben: Einmal zu bewahren gegen die kreischende Ästhetik der bunten Warenwelt, zum zweiten aber den Verstummten eine Art Stimme zu verleihen.
Die Farbe Schwarz ist seit Jahren eine dominante Konstante im Werk von Rainer Wölzl. Neben den pastosen, tendenziell monochromen schwarzen Gemälden, die Wölzl in den letzten Jahrzehnten gemalt hatte, widmete der österreichische Künstler sich in den letzten Jahren vermehrt der Zeichnung. In diesem Medium kommen die elementaren Qualitäten des Zeichnerischen radikal zur Geltung: Linie und Hell-Dunkel. Meist bestehen die aktuellen Arbeiten aus mehreren Teilen, die sich zu einem monumentalen mächtigen Bildpanorama erstrecken. So taucht etwa der Betrachter in die Tiefe der Allee ein, und wird vom extremen Tiefenzug regelrecht angezogen. Er verliert sich in der düsteren Atmosphäre der Landschaft. Der Schatten in seiner Bedeutungsvielfalt, als Projektionsbild, als ein nicht direkt beleuchteter Bereich, als die einem bestimmten Einwirken abgewandte Seite, als ständiger Begleiter und im Kontext von Erinnerung - als etwas kaum mehr Erkennbares, sind das Thema seiner aktuellen Werke.
In der Galerie.Z zeigt Wölzl eine Auswahl von Arbeiten, die um das "Museum der Schatten" entstanden sind. Im Zentrum steht die vor kurzem fertig gewordene Zeichnung "Gras des Vergessens".
Veranstaltungsvorschau: Rainer WÖLZL - Museum der Schatten - Galerie.Z
Keine aktuellen Termine vorhanden!Themenführung: "Kaiserliche Alltagsgeschichten"
Kaiser Franz Josephs spartanischer Lebensstil bestimmte nicht nur den Tagesablauf des Monarchen selbst, sondern auch den des gesamten höfischen Haushalts.
Geschildert wird der kaiserliche Alltag - vom Ritual frühmorgens, wenn der Badewaschler um halb vier Uhr früh seinen Dienst antrat, um dem Kaiser beim Baden behilflich zu sein, bis zum festlichen abendlichen Galadiner.
Neben dem Staatsmann wird auch der Privatmann Franz Joseph und seine zahlreichen Bediensteten vorgestellt. Sie sorgten im Hintergrund für den reibungslosen Ablauf des kaiserlichen Haushaltes.
Veranstaltungsvorschau: Themenführung: "Kaiserliche Alltagsgeschichten" - Hofburg - Silberkammer, Sisi Museum, Kaiserappartements
Keine aktuellen Termine vorhanden!Themenführung: "Sisi und ihre Familie"
In der Mutterrolle fand die Kaiserin keine Erfüllung, sie mied familiäre Anlässe und hatte mit Ausnahme ihrer Lieblingstocher Marie Valerie kein enges Verhältnis zu ihren beiden älteren Kindern Gisela und Rudolf.
Wie kam es zu dieser Entfremdung und wie beeinflusste sie die Lebenswege der Kinder?
Gewinnen Sie außerdem bisher unbekannte Einblicke in Sisis Ehe mit Franz Joseph, die harmonischer als oft dargestellt verlief.
Erfahren Sie mehr von Elisabeths angeblich schlechtem Verhältnis zur Schwiegermutter Sophie und ihre Rolle als Großmutter!

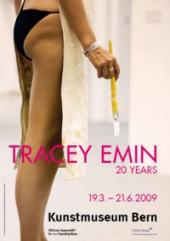










 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner