Tickets und Infos Burgtheater Wien Immanuel Kant
Love Letters
Eine Frau, ein Mann und die Briefe der beiden: Das ist der Stoff, aus dem A. R. Gurneys 1990 für den Pulitzer Preis nominiertes Stück Love Letters ist. Die sich hier schreiben heißen Andy und Melissa - zwei gutbürgerliche „Königskinder“ aus dem Amerika des 20. Jahrhunderts; sie können zusammen nicht kommen, und sie lassen nicht voneinander.
Die Spur ihrer Briefe reicht von den ersten Zettelchen, die sie sich vor dem zweiten Weltkrieg unter der Schulbank zustecken bis in die Zeit der Anrufbeantworter. Es ist die Geschichte einer großen Liebe, intelligent, frech, zuweilen aber auch gedämpft, zweiflerisch und melancholisch - so reflektieren Melissa und Andrew ihre Erlebnisse, ihre Gedanken, ihre Visionen. Melissa immer eine Spur selbstbewusster, ja aufrührerischer - Andrew vernünftig und ausgleichend. Sie ergänzen einander in Gedanken und Gefühlen, aber sie treffen unterschiedliche Lebensentscheidungen, ihre Wege trennen sich. Das Hoffen auf den anderen und seine Antworten aber hört nie auf.
Veranstaltungsvorschau: Love Letters - Theater in der Josefstadt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Maria Stuart
Sie sind Königinnen und Konkurrentinnen. Beide beanspruchen den englischen Thron für sich. Beide lieben ein und denselben Mann. Die eine hat die Staatsmacht, die andere „nur“ die Macht, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Die eine ist die Gefangene der anderen, die andere Gefangene ihrer Rolle. Elisabeth ist beherrscht, ihre Wünsche und Sehnsüchte werden denjenigen des Staates untergeordnet. Maria hingegen ist leidenschaftlich und fähig, heftige Leidenschaften auch in anderen zu entzünden. So kommt es, dass sie ihr Schicksal, die Untergebene zu sein, weder akzeptieren kann noch muss, da die ritterlichen Retter sozusagen Schlange stehen. Dabei ist die Katastrophe schon von Beginn des Stückes an klar: Nicht nur durch die tatsächlichen Mordversuche ihrer Anhänger stellt Maria eine direkte Bedrohung für Elisabeths Regentschaft dar. Sie muss sterben. Das Todes¬urteil ist schon gefällt, jedoch noch nicht vollstreckt. Dazu bedarf es Elisabeths Unterschrift. Doch die zaudert. Sie weigert sich, die Verantwortung zu übernehmen. Und während die unterschiedlichen politischen Lager versuchen, Elisabeth zu beeinflussen, kämpft Maria weiter um einen Ausweg. Als Elisabeth endlich Marias Drängen nach einem gemeinsamen Treffen nachgibt, entlädt sich die auf beiden Seiten unerträgliche Spannung...
Veranstaltungsvorschau: Maria Stuart - Tiroler Landestheater - Großes Haus
Keine aktuellen Termine vorhanden!LILIOM - EINE VORSTADTLEGENDE
Die berührende, bitter-komische Geschichte vom »patscherten« Leben und Sterben des »Hutschenschleuderers« und Vorstadt-Casanovas beschreibt einen anrührenden Teufelskreis: Liliom möchte ein besserer Mensch sein, scheitert aber immer an den eigenen Vorsätzen. Die Spirale aus Abhängigkeit, Sehnsucht und Verletzung, die alle Figuren dieser »Vorstadtlegende« gefangen hält, lässt Liliom brutal zu seiner geliebten Julie sein, führt ihn zu Mord und Selbstmord. Doch so leicht kommt Liliom nicht davon. Er erwacht im Himmel und muss vor den geflügelten Beamten Rechenschaft ablegen. Das Urteil lautet: sechzehn Jahre Fegefeuer, danach darf er »auf Bewährung« noch einmal zurück zur Erde. Kann Liliom seine Chance nutzen oder bleibt er, was er immer war, ein Unverbesserlicher ... ?
Veranstaltungsvorschau: LILIOM - EINE VORSTADTLEGENDE - Schauspielhaus Salzburg
Keine aktuellen Termine vorhanden!Life and Times - Episode 1
Sechzehn Stunden lang ließen sie sich von der vierunddreißigjährigen Katie Farell ihr Leben in kleinsten Details und voller Anekdoten erzählen – von der Geburt bis heute. Ein Leben, das die Truppe um die Regisseure Kelly Copper und Pavol Liska vor allem deshalb interessiert, weil es alles andere ist als ungewöhnlich, und das deshalb in vielem so sehr an unser eigenes erinnert.
Veranstaltungsvorschau: Life and Times - Episode 1 - Kasino am Schwarzenbergplatz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Amphitryon
In Wahrheit handelt es sich um den Gott Merkur, der mit seinem Herrn Jupiter vom Olymp herabgestiegen ist, um in der Gestalt Amphitryons und seines Knechts am Hof von Theben einzukehren, wo Jupiter die Nacht bei der getäuschten Frau des Feldherrn, Alkmene, zubringt.
Veranstaltungsvorschau: Amphitryon - Akademietheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Needlapb 16
Um einen Einblick in ihren einzigartigen Arbeitsprozess zu ermöglichen, präsentiert die Needcompany einmal im Jahr ein Needlapb: eine außergewöhnliche Nacht, zu der nur eine begrenzte Zahl von Zuschauern zugelassen ist.
Needlapb ist das künstlerische Herz der Company, ein Ort, an dem der Arbeitsprozess im Fluss ist, dynamisch und noch keine endgültige Form hat. In diesem Frühjahr schrieb Jan Lauwers das Drehbuch für seinen neuen Film „Dead Deer Don’t Dance“. Das Needlapb 16 im Akademietheater nimmt dieses Drehbuch zur Grundlage. In „Dogville“ zeigte Lars von Trier Theater im Film, die Schauspieler der Needcompany zeigen an diesem Abend Film auf dem Theater.
Veranstaltungsvorschau: Needlapb 16 - Akademietheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Adam Geist
Erlösung findet er nicht. Überall stößt er auf Grausamkeit und Bösartigkeit. Doch wenn es sein muss, wehrt sich Adam. Er wird zum Helden und zum Verlierer. Die größte Tragödie seines Lebens ist, dass er töten muss, was er liebt. Extrem zugespitzt und ins Grotesk-Komische übersteigert, spiegelt Dea Lohers Szenenfolge eine Gesellschaft, die zwischen Hilflosigkeit und Gewalttätigkeit pendelt, ein vorapokalyptisches Szenarium unserer kleinen, alltäglichen Welt, in der ein junger Mensch gut sein will und doch schuldig wird. Hoffnung gibt es nicht. Am Ende seiner Leidensgeschichte hinterlässt Adam den späteren Generationen auf der Erde eine Botschaft, vielleicht.
Veranstaltungsvorschau: Adam Geist - Akademietheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Das ewige Leben
Kaum zurück in seiner Heimatstadt Graz geschieht dem Ex-Polizisten Simon Brenner Ungemach. Als er nach einem Kopfschuss und mehrwöchigem Koma in der Sigmund-Freud-Nervenklinik erwacht, ist er felsenfest davon überzeugt, dass die Grazer Kripo ihn beseitigen wollte. Doch das glaubt ihm natürlich kein Mensch. Die Diagnose des behandelnden Psychiaters: Suizid wegen akuter Depression, ausgelöst durch die Rückkehr nach Puntigam, der Wiege seiner Kindheit. Als Rechtshänder soll er versucht haben, mit einem Schuss in die linke Schläfe seinem Leben ein Ende zu setzen. Brenner weiß, irgendetwas ist faul. Und – eine Erinnerung lässt ihn nicht los: Er glaubt, kurz vor dem schwarzen Loch den Kollegen Aschenbrenner mit einer Pistole gesehen zu haben. Am Faschingsdienstag stiehlt er sich unauffällig aus dem Krankenhaus, um Klarheit in diese undurchsichtige Geschichte zu bringen. Den Schlüssel zur Aufklärung seines eigenen Falls vermutet er in der unrühmlichen Vergangenheit als Polizeischüler. Zusammen mit seinen Ex-Kumpel hat er vor vielen Jahren einen kleinen Banküberfall auf die örtliche Sparkasse verübt, um das gelernte Wissen über Sicherheitssysteme anzuwenden. Mit von der Partie waren Köck, heute Hauswart im Arnold-Schwarzenegger-Stadion, Saarinen, der auf der Flucht tödlich verunglückte und eben dieser Aschenbrenner, unterdessen Kripochef von Graz. Bei seinen Nachforschungen trifft Brenner Zeugen, die leider schon tot sind, legt sich mit Mitgliedern einer selbsternannten Bürgerwehr an, vertraut auf eine handlesende Zigeunerin und findet sogar eine neue Liebe.
Veranstaltungsvorschau: Das ewige Leben - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Der gute Mensch von Sezuan
Drei Götter besuchen die Hauptstadt von Sezuan auf der Suche nach dem einen guten Menschen. Einzig die Prostituierte Shen Te ist bereit, ihnen ein Nachtquartier zu geben und verzichtet auf den nächsten Kunden. Zum Dank erhält sie tausend Dollar und die Ermahnung, weiterhin gütig zu bleiben. Shen Te erwirbt einen Tabakladen und verschließt sich nicht den zahlreichen Bitten ihrer gar nicht so guten Mitmenschen, so dass sie schon nach kurzer Zeit vor dem Ruin steht. In ihrer Not erfindet sie einen Vetter, Shui Ta, in dessen Maske sie mit kaltherzig-konträren Taten das Geschäft retten kann. Als gute Shen Te aber verliebt sie sich in den arbeitslosen Flieger Yang Sun, der sie finanziell skrupellos ausnutzt, so dass Shui Ta bald wieder zu Hilfe eilen muss. Er eröffnet eine Tabakfabrik, in der alle, denen Shen Te geholfen hat, für einen Hungerlohn arbeiten müssen. Des Mordes an der „verschwundenen“ Shen Te angeklagt, kann er/sie sich nur den Göttern offenbaren: „Euer einstiger Befehl / gut zu sein und doch zu leben / zerriss mich wie ein Blitz in zwei Hälften …“
Ong Keng Sen, Regisseur, Performancetheoretiker, Festivalkurator und Kulturkommunikator, ausgebildet in New York, leitet seit 1985 die Theatergruppe „TheatreWorks“ in Singapur. Er befasst sich mit Formen des Austausches zwischen zeitgenössischem Theater und traditionellen Darstellungskulturen. Sein besonderes Interesse gilt dabei der Verbindung von asiatischen und westlichen Kulturen und der Zusammenführung von Künstlern aus den Bereichen Theater, Musik, Tanz, Artistik, Video und visueller Kunst. Was Identität in einer globalisierten Welt bedeutet und bedeuten kann, ist eine der Fragen, die ihn immer wieder antreiben.
Veranstaltungsvorschau: Der gute Mensch von Sezuan - Landestheater Linz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Immanuel Kant
Professor Immanuel Kant ist in Begleitung seiner Frau, seines Bruders Ernst Ludwig und Friedrichs, seines Papageis, auf einem Luxusdampfer unterwegs nach Amerika. Er soll den Ehrendoktortitel der Columbia University empfangen und sich einer Augenoperation wegen eines Glaukoms unterziehen.
Mit ihm auf dem Schiff sind der Kunstsammler Sonnenschein, ein Kardinal, ein alter Admiral und eine Millionärin, die die Hebung der Titanic betreibt. Unentwegt werden alle Mitreisenden von diesem genialen wissenschaftlichen Kauz belehrt, zurecht gewiesen und tyrannisiert. Merkwürdig ist nur, dass der große Philosoph und Aufklärer Immanuel Kant in einem ganz anderen Jahrhundert gelebt hat und, wie man weiß, aus Königsberg nie herausgekommen ist.










 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner 












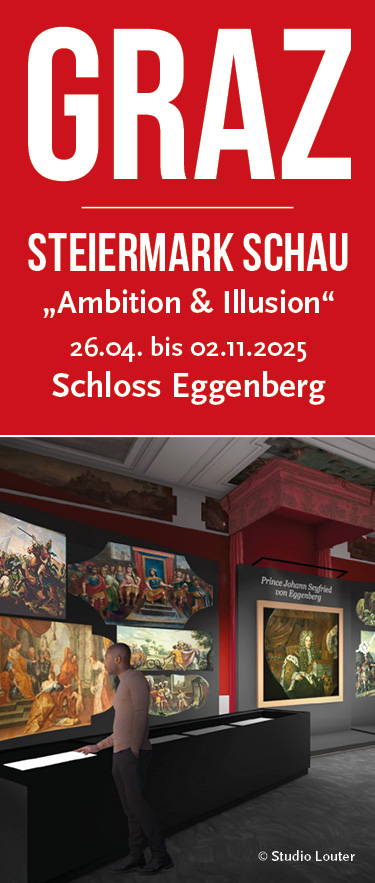







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.