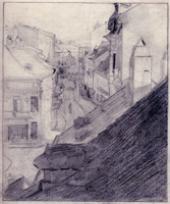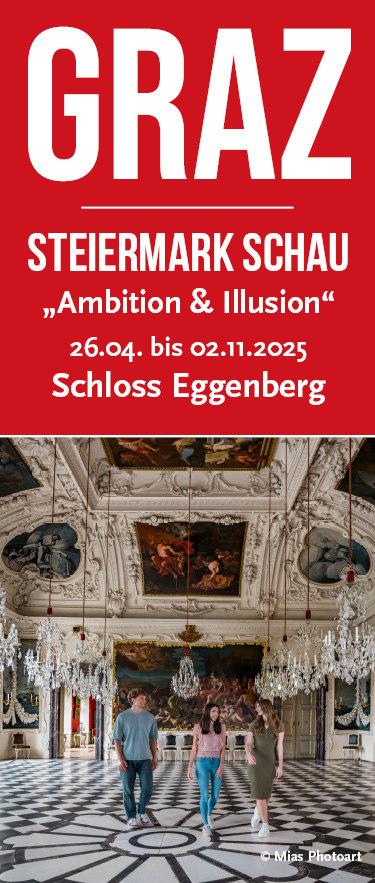Tickets und Infos Technisches Museum Wien Geschmacksache. Was Essen zum Genuss macht
Kreuzungspunkt Linz. Sammlungspräsentation
In der Präsentation Kreuzungspunkt Linz werden nun Werke aus der Kunstsammlung der Stadt Linz von sowohl "emerging" als auch international bereits bekannten KünstlerInnen mit Linz-Bezug innerhalb einer Sammlungsschau der internationalen Kollektion des Lentos themenbezogen vorgestellt. Zur intensiven Auseinandersetzung werden Kapitel zu Themenbereichen wie dem Porträt, der Abstraktion, der Landschaft oder der Wissenschaft eingerichtet.
Die ausgewählten Werke aus der Kunstsammlung der Stadt Linz entsprechen der Ankaufspraxis der AnkaufskuratorInnen der Stadt Linz Johanna Schwanberg und Dieter Buchhart für die Jahre 2007 und 2008 deren Schwerpunktsetzung auf spannenden künstlerischen Positionen liegt, die sich mit gesellschaftsrelevanten Fragestellungen (u. a. Migration, Identität, Soziales, Globalisierung, Genderfragen) auseinandersetzen. Die Betonung liegt dabei auf medienübergreifenden (Relation zwischen Video, Recherche, Performance, Sound, Malerei, Text, Zeichnung, Foto und Objekt), grenzüberschreitenden (Beziehung u. a. zwischen Kunst und Wissenschaft) und experimentellen künstlerischen Ansätzen.
Veranstaltungsvorschau: Kreuzungspunkt Linz. Sammlungspräsentation - Lentos Kunstmuseum Linz
Keine aktuellen Termine vorhanden!ahoi herbert. Bayer und die Moderne
Die Entwicklung und die Geschichte der modernen Kunst wird anhand der Werke von Herbert Bayer und seiner prominenten Wegbegleiter beleuchtet. Viele Querverbindun-gen, die sich durch Bayers abenteuerliche Biografie ergeben werden zum ersten Mal gezeigt: Bayers Einfluss auf die marokkanische Moderne, sein universelles Wirken in New York, Kalifornien, Paris und Mexiko sowie seine Kontakte und Freundschaften mit vielen Künstlern (Moholy-Nagy, Marcel Breuer sowie Walter Gropius) und diversen Kunstszenen der internationalen Avantgarde des 20. Jahrhundert.
Sein Wirken am Bauhaus von 1921 bis 1928 stellt den Schwerpunkt der Ausstellung dar.
Für den großen Auftakt der Feierlichkeiten anlässlich des Jahres 2009, in dem Linz Kulturhauptstadt wird, stehen für die Bayer-Präsentation elf Räume zur Verfügung.
Herbert Bayer war mit der Lentos-Vorgängerinstitution, der Neuen Galerie der Stadt Linz, über Jahrzehnte eng verbunden. Seit einer großzügigen Berücksichtigung im Nachlass der Witwe Joella Bayer im Jahr 2006 verfügt das Lentos mit 135 Arbeiten aus allen Schaffensperioden über den größten Bayer-Bestand österreichischer Museen. Diese Werke bilden zusammen mit zahlreichen Leihgaben aus dem In- und Ausland die Exponate der Ausstellung.
Veranstaltungsvorschau: ahoi herbert. Bayer und die Moderne - Lentos Kunstmuseum Linz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Michaela Melián. Speicher
Thematischer und formaler Ausgangspunkt für Speicher ist VariaVision - Unendliche Fahrt, eine 1965 realisierte, heute verschollene intermediale Arbeit von Alexander Kluge (Texte), Edgar Reitz (Filme) und Josef Anton Riedl (Musik) zum Thema des Reisens. VariaVision bot als Rauminstallation mit gleichzeitigem Vorführen und Wiedergeben von Filmen, mehrkanaliger Musik und Sprache eine neue und andere Wahrnehmung von Musik, Film und Text. Reitz und Kluge unterrichteten an der Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG), die in der kurzen Zeit ihres Bestehens zwischen 1953 und 1968 maßgeblich die deutsche und internationale Design-, Kunst- und Mediengeschichte geprägt hat.
In der Hochschule stand ab 1963 eines der ersten elektronischen Studios in Westdeutschland, das 1959 in München gegründete Siemens-Studio für elektronische Musik. Das Studio mit seinen neuen, rein elektronisch erzeugten Klängen wurde sehr erfolgreich von internationalen Komponisten und Musikproduzenten genutzt. Heute ist es im Deutschen Museum München ausgestellt. Riedl realisierte die Musik für VariaVision in diesem Studio.
Diese Klänge, Töne, Geräusche werden aufgezeichnet und bilden die Basis für eine neue Komposition. In sie eingebettet ertönt eine vielstimmige Collage, ein Textkonvolut zum Thema Reisen und Bewegung. In Speicher wird nicht linear erzählt, sondern Themen, Geschichten und Zeitebenen verschränken sich in tönenden Schleifen und Spiralen mit dem Heute. Mit Speicher realisiert Melián eine Raumsituation, die die Konzeption von VariaVision mittels Projektionen und Wandzeichnungen, Stimme und Musik aufgreift. Die Besucher erleben sich dynamisch als Teil dieser Installation, in der der Standpunkt des Publikums nicht definiert ist.
Veranstaltungsvorschau: Michaela Melián. Speicher - Lentos Kunstmuseum Linz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Kutlug Ataman. Mesopotamische Erzählungen
Die Ausstellung fokussiert die Umbrüche in der Türkei der vergangenen Jahrzehnte, politische, kulturelle und ökonomische Veränderungen, Kämpfe zwischen religiöser und säkularer Weltanschauung und darüber hinaus die Spannung zwischen Osten und Westen, die von Ataman als akute Krise definiert wird. Dabei geht es auch um die Geschichte der westlichen Moderne und die Frage nach der Berechtigung ihres universellen Anspruchs, verbunden mit einer Untersuchung der viel zitierten europäischen "Werte".
Ganz konkret kreist das Thema der Mesopotamischen Erzählungen um Europa, um die Frage nach den geografischen, kulturellen, institutionalisierten, ideellen und ideologi-schen Grenzen des Raumes mit dem Namen "Europa".
Veranstaltungsvorschau: Kutlug Ataman. Mesopotamische Erzählungen - Lentos Kunstmuseum Linz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Linz Blick. Stadtbilder in der Kunst 1909-2009
Die Ausstellung wendet sich an ein neugieriges und kunstinteressiertes Publikum. Ein Topos, ein Ort erzählt, ein Ort schreibt. Er wird von den Menschen, von KünstlerInnen des Ortes abgebildet, geformt, er wird festgehalten. Das hat mit Geschichte (Oral History), Kunstgeschichte, Literatur und Soziologie zu tun. Es ist die Suche nach Befindlichkeiten, nach Beschreibungen, nach Abbildungen, die diese Orte ausmachen. Topographie ist auch Geschichte einer Stadt, eines Ortes, einer Gegend, eines Landes. Orte der Kunst und Kultur, Künstlerateliers und ihre Wohnungen, Häuser - somit auch das Thema Architektur - denn Häuser legen ein beredtes Zeugnis ab über die Menschen einer Stadt.
Veranstaltungsvorschau: Linz Blick. Stadtbilder in der Kunst 1909-2009 - Lentos Kunstmuseum Linz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Jenseits des Himalaya - Guizhou Verborgenes China Unbekannte Kulturen
Die autonome chinesische Provinz Guizhou grenzt an das tibetische Hochplateau. Dort leben fünfzehn nicht Han Chinesische Völker, deren eigenständige Kulturen sich in dem unzugänglichen Hochland bis heute erhalten haben.
Dank dem Entgegenkommen der Volksrepublik China können die ausgestellten und beeindruckenden Zeugnisse dieser im Ausland nahezu unbekannten Kulturen den Menschen in unserem Lande zugänglich gemacht werden.
Gezeigt werden eine Vielzahl von Kulturen-, Kunst- und Gebrauchsgegenständen, hunderte Raritäten von Gestern und Heute, die Professor Liu Yong dem Schloss Halbturn aus seiner großen Sammlung, zur Verfügung gestellt hat.
Professor Liu Yong ist einer der angesehensten Künstler Chinas. Er entstammt der Buyi-Dynastie und ist in GUIZHOU aufgewachsen.
Die reichhaltige Auswahl der Objekte, bietet einen umfassenden Einblick in außergewöhnliche Kulturen, die sich in einer der schwer zugänglichen Provinzen im Südwesten Chinas bis heute erhalten haben.
In der Ausstellung werden gezeigt: bunte Stickereien, Stoffe und Gewänder, sakrale Gegenstände, Plastiken, Masken, Holzschnitzereien, Rollenbilder, Porzellan und Silberschmuck: alles Besonderheiten von einzigartiger Schönheit. Die Objekte stammen von Menschen, die ihre Sprache, ihre religiösen Rituale und ihr Brauchtum bewahrt haben, die aber bis heute keine eigene Schrift kennen.
Veranstaltungsvorschau: Jenseits des Himalaya - Guizhou Verborgenes China Unbekannte Kulturen - Schloss Halbturn
Keine aktuellen Termine vorhanden!Jugend.Stil in St. Pölten
In dieser neuen Umgebung werden neben den Highlights der St. Pöltner Jugendstilkunst von Charlotte Andri-Hampel, Ferdinand Andri, Ernst Stöhr, Hans Ofner und Joseph Maria Olbrich neue, unbekannte Kunstwerke präsentiert, die teilweise aus Privatbesitz stammen und erstmals in musealem Rahmen gezeigt werden können.
Löffler und Moll gehören ohne Zweifel zu den bedeutendsten Proponenten der Österreichischen Kunst um 1900 - mit den präsentierten Exponaten kann ihre enge Beziehung zum St. Pöltner Künstlerkreis der damaligen Zeit erstmals aufgezeigt werden.
Mehrfach wurden Kunstwerke des Jugendstils aus dem Besitz des St. Pöltner Stadtmuseums in den letzten Jahren im Ausland gezeigt, so waren Werke u.a. in Montreal, Mailand und Paris zu sehen, was ihre hohe Qualität noch einmal deutlich unterstreicht!
Veranstaltungsvorschau: Jugend.Stil in St. Pölten - Stadtmuseum St. Pölten
Keine aktuellen Termine vorhanden!Go Modelling 2009 - Die österreichische Ausstellung für Maßstabsmodellbau
Gezeigt werden u. a. zahlreiche maßstabsgetreue Modelle historischer Militärfahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe.
Veranstaltungsvorschau: Go Modelling 2009 - Die österreichische Ausstellung für Maßstabsmodellbau - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!Spätsommer '68. Der Einsatz des Österreichischen Bundesheeres
Vor 40 Jahren, in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968, überquerten Truppen des Warschauer Paktes die Grenze zur CSSR. Österreich war als unmittelbarer Nachbar nicht nur Zeuge des Geschehens, sondern war auch militärisch darin verwickelt.
Zwölf Jahre nach der Ungarnkrise bezog das Bundesheer neuerlich Stellung im Grenzgebiet zu einem Nachbarn, diesmal allerdings nicht direkt an der Grenze.
Die Schau ist in fünf Teile gegliedert, von der Alarmierung über den Einsatzraum bis hin zum Ende des Einsatzes, in dem der Verlauf aus verschiedenen Perspektiven analysiert wird.
In einem wie in den 60er Jahren ausgestatteten Kinosaal können Besucher Originalaufnahmen aus der CSSR und ORF-Nachrichtensendungen aus dieser Zeit sehen. Dazu kommen Interviews mit Zeitzeugen, die als Militärs den Einsatz miterlebt haben.
Veranstaltungsvorschau: Spätsommer '68. Der Einsatz des Österreichischen Bundesheeres - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!Geschmacksache. Was Essen zum Genuss macht
Die Ausstellung "Geschmacksache. Was Essen zum Genuss macht" zeigt, wie durch Verarbeitung der Nahrungsmittel Geschmack entsteht, und wie gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren, Ernährungsgewohnheiten oder Lebensstilfragen das Geschmackserlebnis und die Esskultur beeinflussen. Denn nicht nur Zunge und Nase bestimmen, ob uns etwas schmeckt oder nicht - das Ambiente, gesellschaftliche Konventionen, Vorstellungen und Erwartungen spielen eine ebenso große Rolle.















 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner