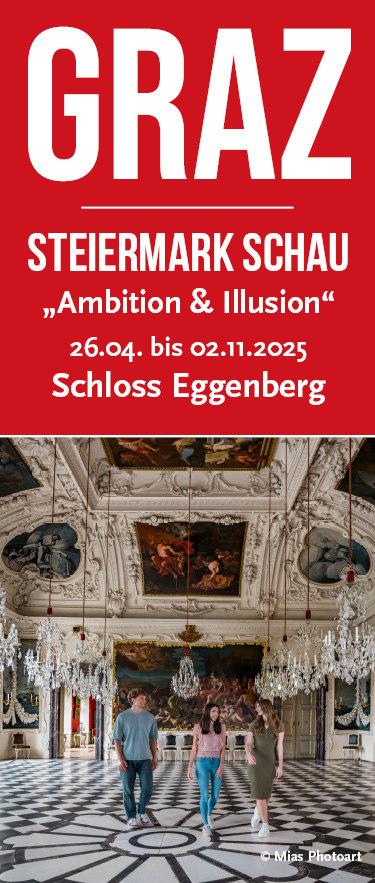Tickets und Infos Kasino am Schwarzenbergplatz Life and Times - Episode 1
Essig & Öl
Der Greißler Seiberl, der die Wirtschaftskrise und die erdrückende Konkurrenz von aufstrebenden Konsum-Genossenschaften nicht mehr verkraften kann, versucht seinem Leben ein Ende zu setzen. Da kommt das Kindermädchen Annie in sein Geschäft und bittet in der Stunde der Not ausgerechnet Seiberl um einen Spagat. Annie macht Seiberl wieder Mut, und es kommen auch neue Kunden. Seiberls Geschäft kommt nach einigen humoristischen Wirren wieder in die Höhe und gibt uns mit neuem optimistischen Schwung einiges an Lebensweisheit mit, denn „.....der Doktor Lueger hat ihm einmal die Hand gereicht“.
Veranstaltungsvorschau: Essig & Öl - Gloria Theater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Die sexuellen Neurosen unserer Eltern
Dora ist ein junges Mädchen und nicht ganz richtig im Kopf, aber ihre Eltern lieben sie. Sie hat einen Job, kann sich benehmen, ist herzeigbar und stets sauber. Mit Absetzen der jahre-lang eingenommenen ruhig stellenden Medikamente erwacht in Dora allerdings nicht nur eine großer Selbstständigkeitsdrang sondern auch eine naive, ungezügelte, wilde Sexualität, mit der Dora ihre Umgebung vor den Kopf stößt. Noch viel mehr, weil sich ein feiner Herr findet, mit dem sie ihre Sexualität auch ausleben kann. Und weil der es so will, wäscht sie sich auch nicht mehr. Auch ihr Sprechen wandelt sich, sie plappert nicht mehr nur nach. Dora spricht direkt an, was sich ihre Mitmenschen nur zu umschreiben getrauen. Dabei werden die verklemmten Vorstellungen einer Gesellschaft offenbart, in der das Kranke noch natürlicher ist als das Normale. Letztlich ist es aber auch die Geschichte einer Menschwerdung - die Erzählung einer Befreiung aus der Unterdrückung.
Veranstaltungsvorschau: Die sexuellen Neurosen unserer Eltern - neuebuehnevillach
Keine aktuellen Termine vorhanden!Paradiso
Direkt, resolut und eigensinnig agiert Hilde Sochor in der Rolle der pensionierten Schuldirektorin Martha, selbstbewusst und einfühlsam spielt Katharina Scholz-Manker die jüngere Vicky, die immer mehr und immer folgenreichere Entscheidungen für Martha trifft...
Regie und Bühne: Matthias Levèfre
Buch: Lida Winiewicz
Veranstaltungsvorschau: Paradiso - stadtTheater walfischgasse
Keine aktuellen Termine vorhanden!Heute Abend: Lola Blau
Es beginnt eine Odyssee über die Schweiz, Frankreich, Paris nach Amerika, immer auf Durchreise, immer in den Wartesälen des Lebens, vom Tingel-Tangel-Girl zur Hollywood Diva, und zurück in das zerstörte Europa, auf der Suche nach Ihrer großen Liebe. Im Handgepäck das Akkordeon.
Veranstaltungsvorschau: Heute Abend: Lola Blau - stadtTheater walfischgasse
Keine aktuellen Termine vorhanden!Sugar - Manche mögen´s heiß
„Some Like It Hot" wurde 2001 von der amerikanischen Kritikergilde zum besten Film des 20. Jahrhunderts gewählt. Die schnellen Dialoge, die aberwitzigen und slapstickgeladenen Situationen und die detailliert und pointiert gezeichneten Charaktere sind heute genauso modern und zeitlos wie damals.
Veranstaltungsvorschau: Sugar - Manche mögen´s heiß - Kammerspiele
Keine aktuellen Termine vorhanden!Der blaue Engel
„Da er Rath hieß, nannte die ganze Schule ihn Unrat.“ - Der tyrannische und verknöcherte Gymnasiallehrer Professor Rath, der sein bisheriges Leben der Mission der Bildung untergeordnet hatte, gerät auf der fanatischen Jagd seiner ihn peinigenden Schüler in die Fänge eines verwirrend-fremdartigen Dunstkreises, der erotischen Halbwelt. Sie, das ist Lola, eine „ Barfußtänzerin“ im Tingeltangel Variéte „Der blaue Engel“. Für Unrat bleibt sie die „Künstlerin“; auch dann noch, als er sich um Ruf und Stellung sorgen muss und diese schließlich verliert.
Der blaue Engel - Eine Satire über eine ungleiche Liebe? Auf alle Fälle ist diese Geschichte das Psychogramm einer exotischen Beziehung, die sich ihr Recht erwirkt, wenn die gesellschaftlichen und politischen Mechanismen durchschaut sind. „Unrat, dieses lächerliche Scheusal ... hat doch einige Ähnlichkeit mit mir“, so der Autor Heinrich Mann in einem wenig beachteten Zitat über eine Gestalt, die seinen Weltruhm als Autor begründen und ihn für den amerikanischen Film interessant machen sollte. Ein viertel Jahrhundert nach Erscheinen des Buches lernte er Ende der Zwanziger Jahre im berüchtigten Westberliner Amüsierviertel Nelly Kröger kennen; ein Mädchen mit der „Seele der Halbwelt“. Kurz darauf wurde nach der Romanvorlage der erste deutsche Tonfilm gedreht: „Der blaue Engel". Marlene Dietrich war mit einem Schlag berühmt, und mit ihr trat Heinrich Mann endlich aus dem Schatten seines Bruders, des Nobelpreisträgers. Die verpönte Nelly Kröger sollte seine Begleiterin ins Exil werden. Leben und Literatur - einmal mehr im Leben der Manns erwies sich das eigene literarische Werk für Heinrich als self-fulfilling prophecy.
Veranstaltungsvorschau: Der blaue Engel - Theater in der Josefstadt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Love Letters
Eine Frau, ein Mann und die Briefe der beiden: Das ist der Stoff, aus dem A. R. Gurneys 1990 für den Pulitzer Preis nominiertes Stück Love Letters ist. Die sich hier schreiben heißen Andy und Melissa - zwei gutbürgerliche „Königskinder“ aus dem Amerika des 20. Jahrhunderts; sie können zusammen nicht kommen, und sie lassen nicht voneinander.
Die Spur ihrer Briefe reicht von den ersten Zettelchen, die sie sich vor dem zweiten Weltkrieg unter der Schulbank zustecken bis in die Zeit der Anrufbeantworter. Es ist die Geschichte einer großen Liebe, intelligent, frech, zuweilen aber auch gedämpft, zweiflerisch und melancholisch - so reflektieren Melissa und Andrew ihre Erlebnisse, ihre Gedanken, ihre Visionen. Melissa immer eine Spur selbstbewusster, ja aufrührerischer - Andrew vernünftig und ausgleichend. Sie ergänzen einander in Gedanken und Gefühlen, aber sie treffen unterschiedliche Lebensentscheidungen, ihre Wege trennen sich. Das Hoffen auf den anderen und seine Antworten aber hört nie auf.
Veranstaltungsvorschau: Love Letters - Theater in der Josefstadt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Maria Stuart
Sie sind Königinnen und Konkurrentinnen. Beide beanspruchen den englischen Thron für sich. Beide lieben ein und denselben Mann. Die eine hat die Staatsmacht, die andere „nur“ die Macht, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Die eine ist die Gefangene der anderen, die andere Gefangene ihrer Rolle. Elisabeth ist beherrscht, ihre Wünsche und Sehnsüchte werden denjenigen des Staates untergeordnet. Maria hingegen ist leidenschaftlich und fähig, heftige Leidenschaften auch in anderen zu entzünden. So kommt es, dass sie ihr Schicksal, die Untergebene zu sein, weder akzeptieren kann noch muss, da die ritterlichen Retter sozusagen Schlange stehen. Dabei ist die Katastrophe schon von Beginn des Stückes an klar: Nicht nur durch die tatsächlichen Mordversuche ihrer Anhänger stellt Maria eine direkte Bedrohung für Elisabeths Regentschaft dar. Sie muss sterben. Das Todes¬urteil ist schon gefällt, jedoch noch nicht vollstreckt. Dazu bedarf es Elisabeths Unterschrift. Doch die zaudert. Sie weigert sich, die Verantwortung zu übernehmen. Und während die unterschiedlichen politischen Lager versuchen, Elisabeth zu beeinflussen, kämpft Maria weiter um einen Ausweg. Als Elisabeth endlich Marias Drängen nach einem gemeinsamen Treffen nachgibt, entlädt sich die auf beiden Seiten unerträgliche Spannung...
Veranstaltungsvorschau: Maria Stuart - Tiroler Landestheater - Großes Haus
Keine aktuellen Termine vorhanden!LILIOM - EINE VORSTADTLEGENDE
Die berührende, bitter-komische Geschichte vom »patscherten« Leben und Sterben des »Hutschenschleuderers« und Vorstadt-Casanovas beschreibt einen anrührenden Teufelskreis: Liliom möchte ein besserer Mensch sein, scheitert aber immer an den eigenen Vorsätzen. Die Spirale aus Abhängigkeit, Sehnsucht und Verletzung, die alle Figuren dieser »Vorstadtlegende« gefangen hält, lässt Liliom brutal zu seiner geliebten Julie sein, führt ihn zu Mord und Selbstmord. Doch so leicht kommt Liliom nicht davon. Er erwacht im Himmel und muss vor den geflügelten Beamten Rechenschaft ablegen. Das Urteil lautet: sechzehn Jahre Fegefeuer, danach darf er »auf Bewährung« noch einmal zurück zur Erde. Kann Liliom seine Chance nutzen oder bleibt er, was er immer war, ein Unverbesserlicher ... ?
Veranstaltungsvorschau: LILIOM - EINE VORSTADTLEGENDE - Schauspielhaus Salzburg
Keine aktuellen Termine vorhanden!Life and Times - Episode 1
Sechzehn Stunden lang ließen sie sich von der vierunddreißigjährigen Katie Farell ihr Leben in kleinsten Details und voller Anekdoten erzählen – von der Geburt bis heute. Ein Leben, das die Truppe um die Regisseure Kelly Copper und Pavol Liska vor allem deshalb interessiert, weil es alles andere ist als ungewöhnlich, und das deshalb in vielem so sehr an unser eigenes erinnert.

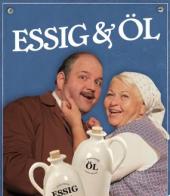








 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner