Tickets und Infos Museum des Nötscher Kreises Gerhart Frankl/Anton Kolig – Künstlerische Begegnungen
Zwischen Tradition und Erneuerung
Kunst aus Japan. Heian – Genzai
Im Jahr 2009 feiern Österreich und Japan 140 Jahre diplomatische Beziehungen. Dies, die Städtefreundschaft Salzburgs mit Kawasaki und der persönliche Kontakt zum international tätigen Manager Mitsugo Sato sind Anlass, im Salzburg Museum eine Ausstellung japanischer Kunst zu zeigen. Dabei spannt sich der zeitliche Bogen der gezeigten Arbeiten vom 10. Jahrhundert (Heian-Periode) bis in die Gegenwart (Genzai). Neben ausgewählten Objekten der Sammlung der Konoe-Familie (aus der Yomei Bunko Foundation, Kioto) werden in der Ausstellung japanische Grafik, Kalligrafie und Textilien, eine Salzburger Privatsammlung von Hiroshige-Holzstichen und japanische Werke aus dem Nachlass des lange Jahre in Japan lebenden Salzburger Künstlers Hermann Freudlsperger (1887–1956) präsentiert.
Begleitend zur Ausstellung findet der Besucher im ersten Obergeschoss des Salzburg Museums ein original japanisches Restaurant, das von dem Tokioter Restaurantchef Tetsuo Aoki geführt wird. Der japanische Spitzenkoch Junichi Ishida, der zu den besten „Kaiseki“-Köchen der Welt zählt, wird die Gaumen mit Topqualität verzücken. Für das perfekte japanische Ambiente im Restaurant und auf der Terrasse über dem Residenzplatz sorgt der renommierte Architekt Yoshihiro Hirotani. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Theater, Tanz und Kalligrafie-Workshop, mit Kimono-Vorführung und Sake-Verkostung entführt die Besucher in das Land der aufgehenden Sonne. Die Eröffnung der Sonderausstellung findet am Samstag, dem 18. Juli 2009, um 10.30 Uhr in der Kunsthalle des Salzburg Museums in der Neuen Residenz statt.
18. Juli bis 30. August 2009
Rudolf Szyszkovits (1905–1976)
Der den Großteil seines Lebens in Graz lebende und wirkende Maler war mit Salzburg nicht nur familiär verbunden, indem er einen Teil seiner Kindheit bei den Großeltern in der Stadt Salzburg verbrachte, sondern war auf Empfehlung von Oskar Kokoschka auch viele Jahre an der Sommerakademie tätig. Die Grundlage für sein künstlerisches Schaffen wie für seine Lebenshaltung war eine tiefe, undogmatische Religiosität, die ihn früh zum reformkatholischen Bund Neuland führte, wo er unter anderem Freundschaft mit dem nachmaligen Salzburger Landeshauptmann Hans Lechner schloss. Seine ausdrucksstarken Landschaften vermitteln die Begeisterung für die Natur als ursprüngliche göttliche Schöpfung.
Die große Ausstellung – konzipiert in Zusammenarbeit mit der Grazer Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum – bietet Einblick in sein gesamtes Œuvre mit Zeichnungen, Aquarellen und Ölbildern. Die Eröffnung der Sonderausstellung findet am Samstag, dem 26. September 2009, um 10.30 Uhr in der Kunsthalle des Salzburg Museums in der Neuen Residenz statt.
26. September 2009 bis 10. Januar 2010
Höhenrausch
Im letzten Teil der Trilogie Kunst in die Stadt!! verlassen OK und Linz09 den sicheren Boden und setzen neue Höhepunkte. Nach Schaufenstern und Stollen werden die Dächer im Zentrum von Linz bespielt und begangen. Besucher(innen) treffen dabei nicht nur auf spektakuläre Kunstwerke internationaler Künstler(innen), sondern lernen Linz aus einem völlig neuen Blickwinkel kennen: Stadtgeschichte, städtische Infrastruktur oder Architektur wird genauso Thema sein wie Himmelsmythologien oder der Sternenhimmel über Linz.
Über eine Himmelsstiege im OK steigen die Besucher(innen) bis über die Dächer der Innenstadt und erkunden die einzelnen Stationen der Ausstellung.
Sie drehen eine Runde mit dem Riesenrad und genießen auf dem höchsten Punkt ein kleines städtisches Paradies.
Über einen Dachsteg wandern sie anschließend über den größten Dachgarten von Linz und entdecken die urbane Silhouette.
Das Freideck des OK ist gleichzeitig Lounge und Poststation, von wo aus die Besucher(innen) ihre Höhenrausch-Grußbotschaften versenden. Vorbei an den Türmen der Ursulinenkirche werfen die Besucher(innen) einen Blick von oben in den Kirchenraum, streifen durch die alten Dachböden aus dem 17. Jahrhundert und kehren dann wieder auf den Boden zurück.
29. Mai bis 31. Oktober 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Napoleon auf Schloss Schallaburg
Napoleon – menschlicher Übermensch
Die Ausstellung widmet sich Napoleons Persönlichkeit und Leben in allen Facetten. Sie zeigt, wie der junge korsische Aristokrat seine Karriere als französischer Kadett beginnt, innerhalb kurzer Zeit zum Alleinherrscher über Frankreich aufsteigt, Europa neu ordnet und im Alleingang ein französisches Imperium errichtet. Gezeigt werden sein politischer Niedergang und sein Tod in der Verbannung auf Sankt Helena. Napoleon war nicht nur großer General und Politiker, sondern auch Gesetzesinitiator, Familienmensch sowie Förderer der Künste. Kostbare Exponate aus bedeutenden Museen der Welt, wie dem Kunsthistorischem Museum Wien, dem Louvre und der Fondation Napoléon in Paris oder der Eremitage in Sankt Petersburg, illustrieren sein Wirken und Schaffen – das sich teilweise bis in unsere Zeit auswirkt. Mit seiner Tatkraft stellte Napoleon den „Code Napoléon“ fertig, das Gesetzbuch, das als „Code civil“ in wesentlichen Teilen in Frankreich noch heute gültig ist. Selbst die Verbreitung des metrischen Systems, von Meter bis Kilogramm, ist auf Napoleon zurückzuführen.
Napoleon und Österreich
Ein Schwerpunkt der Ausstellung beschäftigt sich mit der Beziehung Napoleons zu Österreich. Das Gedenkjahr der Schlachten von Aspern und Wagram (1809) geben Grund genug, neben den militärischen Konflikten auch eine Phase des Bündnisses zwischen Österreich und Frankreich zu beleuchten. Dieses Bündnis wurde durch die Heirat mit Marie Louise, der Tochter von Kaiser Franz I., besiegelt. Nicht zuletzt war die Entscheidung Österreichs, die Allianz mit Napoleon zu beenden, ein Beitrag zu seinem Scheitern.
Entspannung oder Abenteuer – je nach Geschmack
Neben der Ausstellung bieten zahlreiche Feste im Zeichen Napoleons – vom Familienfest bis zum Seniorenfest – für Junge und Junggebliebene spannende Unterhaltung. Ein besonderes Highlight ist das originalgetreu nachgebaute napoleonische Feldlager mit angrenzendem napoleonischem Kräutergarten im Freibereich des Schlosses. Spezielle Schauzelte zeigen, mit welcher Ausrüstung unter Napoleon in den Krieg gezogen wurde. Und jeden Sonntag sowie an Feiertagen warten Animateure mit Unterhaltung aus der damaligen Zeit auf alle Napoleon-Fans.
Der historische Turniergarten lädt Besucher ein, seine Geheimnisse zu entdecken oder einfach die Seele baumeln zu lassen. Er bezaubert durch historische Rosen, Ziergehölze und Kräuter sowie durch die beiden für die Renaissancezeit typischen Apfelhaine. Drei Wanderwege rund um die Schallaburg machen das Schloss zum perfekten Ausflugsziel. Im Schlossrestaurant schließlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.
Napoleon – Feldherr, Kaiser und Genie
16. Mai bis 1. November 2009
Schloss Schallaburg,
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Vermählung auf Schloss Dyck – Rheingold und die Sammlung Speck
In über vier Jahrzehnten hat der Kölner Prof. Dr. Reiner Speck eine international renommierte Sammlung zeitgenössischer Kunst zusammengetragen. Ein großer Teil dieser Kollektion konnte im vergangenen Jahr als zusammenhängende Werkgruppe von der Familie Viehof erworben werden und wird von nun an über die Sammlung Rheingold der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Diesen Akt der Zusammenführung vergleicht Prof. Speck mit einer Heirat, und entsprechend wird zur „Vermählung auf Schloss Dyck“ geladen. „Geleitet von Vernunft und Tradition, ist es gelungen, etwas Großes zu erhalten“, so Prof. Speck. Er sieht seine ehemalige Kollektion in der Sammlung Rheingold gut aufgehoben, umso mehr, als sie im Rheinland verbleibt und eine sich über Jahre erstreckende Präsenz in Schloss Dyck vorgesehen ist. Die Sammlung Speck entstand aus dem Geist einer fruchtbaren Symbiose zwischen Büchern und Bildern.
Der Kurator, Kay Heymer, ist mit den Beständen der Sammlung Speck bestens vertraut und gilt als Kenner der zeitgenössischen Kunstszene. Bereits in früheren Jahren hat er die Sammlung mit musealen Inszenierungen begleitet.
Die Ausstellung in Schloss Dyck zeigt Werke von zwölf Künstler(inne)n: Carl Andre, Joseph Beuys, Dan Flavin, Günther Förg, Georg Herold, Martin Kippenberger, Jannis Kounellis, Mario Merz, Raymond Pettibon, Tobias Rehberger, Sigmar Polke und Rosemarie Trockel. Diese Auswahl verdeutlicht die Bandbreite der Sammlung, die aus Werken besteht, deren historische Positionierung sich erst allmählich vollzog und die heute als klassische Avantgarde bezeichnet werden kann.
Gut 90 Exponate umfasst diese Präsentation, von denen zahlreiche Werke einen engen Bezug zur Sprache haben. Die Sammlung Speck ist geradezu gekennzeichnet von einer Fülle poetischer Objekte, von Kunstwerken, deren Faszination nicht allein in ihrer Form und ihrem Material liegt, sondern in ihrer Thematik. Viele dieser Arbeiten nehmen Bezug auf grundlegende Themen des menschlichen Lebens – Geburt, Sexualität, Altern und Tod, Obsessionen und Passionen, politische und wirtschaftliche Fragen: Venus Ellipse, Mountains of Cocaine, Geld spielt keine Rolle, Telepathische Sitzung lauten einige der Werktitel. Die Kunst mit ihrer vielschichtigen Erzählstruktur und ihrer Doppelbödigkeit erweist sich als ideales Mittel, um Themen zu formulieren, die uns alle angehen.
Die Entstehung der Sammlung Speck ist geprägt vom Aufbruch der Kunst der 1960er-Jahre. Die älteren Künstler der Sammlung – Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Mario Merz, Carl Andre, Dan Flavin, Sigmar Polke – sind bedeutende Vertreter dieser Künstlergeneration, deren ausgeprägtes politisches Bewusstsein sich einerseits in schlagend plakativen und andererseits in rätselhaften Werken niederschlug. Die Polarität zwischen den Werken Dürer, ich führe Baader und Meinhof durch die Dokumenta und Mensch von Joseph Beuys macht das deutlich. Die Sammlung Speck stellt ein Netzwerk von subtil verknüpften Arbeiten dar, die an den Betrachter nicht allein körperliche, sondern auch geistige Herausforderungen stellt. Sehen und Denken sind hier untrennbar.
Informationen
bis 30. Dezember 2009
Stiftung Schloss Dyck, Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur, D-41363 Jüchen
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Bello impossibile
Für den Stuttgarter Diplomaten Franz von Koenig-Fachsenfeld ging im Herbst 1899 ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Es gelang dem erklärten Kunstliebhaber und Italienkenner, die letzten 935 Zeichnungen aus der Sammlung des Bologneser Malers Francesco Giusti zu erwerben und damit den Grundstock für die eigene Sammlung „alter Meister“ deutlich zu erweitern. Bereits im Jahr davor hatte er 120 Blätter aus verschiedenen Kunstlandschaften Italiens aus der Sammlung Certani erworben. In den folgenden Jahren ergänzte Franz von Koenig seine Bestände Zug um Zug und mit europäischer Perspektive. Arbeiten von Nicolas Poussin oder Jacques Callot faszinierten ihn ebenso wie die Niederländer Philips Wouwerman oder Caspar Netscher. Aus Deutschland kommen Johann Heinrich Tischbein der Ältere, Caspar David Friedrich oder Felix Hollenberg. Eine Sonderstellung innerhalb der Sammlung nimmt der Komplex von 450 Zeichnungen von Hermann Pleuer zum Thema Eisenbahn ein.
Nicht nur wegen ihrer hohen Qualität gilt die Sammlung Schloss Fachsenfeld in Fachkreisen als einzigartig. Mit ihren zirka 2600 Zeichnungen italienischer, französischer, niederländischer und deutscher Künstler des 15. bis frühen 20. Jahrhunderts ist sie gleichzei-
tig eine der großen Sammlungen, die bis auf den heutigen Tag unangetastet zusammengeblieben sind. Seit 1976 befindet sich die Sammlung Schloss Fachsenfeld als Dauerleihgabe der Stiftung Schloss Fachsenfeld in der Staatsgalerie Stuttgart.
110 Jahre nach dem Erwerb der Bologneser Handzeichnungen bietet die Ausstellung Bello impossibile zum ersten Mal auf dem historischen Landsitz der Familie von Koenig Einblicke in diese Schätze europäischer Zeichenkunst. Die 110 Stücke, die in der historischen Galerie und dem Vorbereich präsentiert werden, bieten im „Jahr der Grafik“ einen repräsentativen und aktuellen Überblick über den Reichtum und die Vielfalt der Sammlung.
Schloss und englischer Landschaftspark bilden außerdem eine ideale Umrahmung für ein Vergnügen, das Johann Wolfgang von Goethe ganz treffend beschrieb: „Ich konnte kein größere Freude finden, als wenn ich Skizzen vor mir sah. Das kühn Hingestrichene, kühn Ausgetuschte und Gewaltsame reizte mich, selbst das, was mit wenigen Zügen die Hieroglyphe einer Fraktur war, wusste ich zu lesen und schätzte ich übermäßig.“
Informationen
16. Mai bis 16. August 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Jenseits des Himalaya – Guizhou – verborgenes China – unbekannte Kulturen
Mittelpunkt der Ausstellung ist die Lebensart von Menschen, die sich, obwohl sie an der Grenze zum tibetischen Hochland leben, wesentlich in Erscheinung, Kultur, Sprache, Brauchtum und Wesen von Tibetern und Han-Chinesen unterscheiden.
Die einzigartige Sammlung des chinesischen Künstlers Prof. Liu Yong beinhaltet Zeichnungen auf Papierrollen, Textilien und Gewändern, Plastiken, Keramik, Porzellan, Schmuck und Holzmasken – alles von besonderer Schönheit. Außerdem sind Exponate aus exquisiten privatren Sammlungen zu bewundern. Die Ausstellung präsentiert auch viele exotisch anmutende Gebrauchsgegenstände, die bis heute von den dort lebenden Volksgruppen verwendet werden.
Die rar gewordenen Objekte repräsentieren die Kultur von 15 Minderheitsvölkern, die in der chinesischen Provinz Guizhou leben. Guizhou ist mehr als doppelt so groß wie Österreich und hat 36 Millionen Einwohner. Die Provinz liegt auf einem Hochplateau, auf dem es noch Siedlungen gibt, die nur zu Fuß zu erreichen sind.
24. April bis 26. Oktober 2009
Di–So und Fei 10–18 Uhr
Wein und Kulinarik auf Schloss Halbturn
Der Besuch der Konzerte lässt sich ideal mit anderen Programmpunkten auf Schloss Halbturn verbinden. Abgesehen von der Ausstellung Jenseits des Himalaya im Schloss lohnen sich auch eine Führung durch die einzigartige Schlosskellerei und eine Verkostung der Weine des traditionsreichen Weinguts von Schloss Halbturn. Im Restaurant Knappenstöckl im Schlosshof kann der Abend dann gemütlich ausklingen, um schließlich in einem der 14 neu errichteten Schlosszimmer einem erholsamen Schlaf nachzugehen.
www.knappenstoeckl.at
Informationen
Weitere Veranstaltungen auf Schloss Halbturn
Château Classic
Kammermusik auf höchstem Niveau
30. Mai, 7. und 14. Juni 2009
Halbturner Schlosskonzerte
an Samstagen im Juli und August um 19.30 Uhr
Gartenlust auf Schloss Halbturn
21., 22. und 23. August 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Glanzstücke – Schmuck der Wiener Werkstätte
Die individuelle Zeichnung und Farbigkeit von Schmucksteinen wie Lapislazuli, Malachit oder Opal wurde der lupenreinen Perfektion von Brillanten vorgezogen. Die Ausstellung Glanzstücke – Schmuck der Wiener Werkstätte im Schmuckmuseum Pforzheim präsentiert rare Spitzenstücke die-
ser Produktionsgemeinschaft von 1903 bis 1920. Entwurfszeichnungen und historische Fotografien geben darüber hinaus tieferen Einblick in Umfang und stilistischen Wandel des Schmucks dieser Jahre. In Kooperation mit dem Wien Museum und der Neuen Galerie New York ist eine einzigartige Zusammenschau entstanden, die nach der Präsentation im Wien Museum ausschließlich im Schmuckmuseum Pforzheim zu sehen ist.
Die Künstler der Wiener Werkstätte brachten Glanzstücke von radikaler Modernität hervor. Sie wandten sich gegen industrielle Massenproduktion und dagegen, Vergangenes zu kopieren. Dem Reformgeist der Wiener Secession gemäß forderten sie Formen, die der Zeit entsprachen, und rückten ideelle Werte und Ästhetik in den Mittelpunkt. Schmuck war seit dem ersten Jahr nach der Gründung der Wiener Werkstätte von Josef Hoffmann, Koloman Moser und dem Bankier Fritz Wärndorfer am 12. Mai 1903 das bevorzugte künstlerische Medium, gleichsam die Krönung des Schaffens neben Objekten des Alltags, Grafik, Mode oder Interieurs und Architektur. Außer den Gründungsmitgliedern Hoffmann und Moser zeichneten auch Eduard Wimmer-Wisgrill, Carl Otto Czeschka und Dagobert Peche für die Werke verantwortlich, die häufig Unikate waren.
Eine besondere Rolle im Wiener Kunstfrühling nahm Emilie Flöge ein, Lebensgefährtin und Muse von Gustav Klimt. Die emanzipierte moderne Frau trat als „Fotomodell“ und Mittlerin für den Schmuck der Wiener Werkstätte in Erscheinung, und der von ihr mitgeführte Modesalon „Schwestern Flöge“ war eine Drehscheibe des Schmuckverkaufs. Von Gustav Klimt, der Emilie Flöge 1902 porträtierte, erhielt die Modeschöpferin mehrere Schmuckstücke der Wiener Werkstätte geschenkt, von denen einige in der Ausstellung präsentiert werden.
Die Leihgaben für Glanzstücke stammen aus dem Wien Museum und der Neuen Galerie New York sowie aus Privatsammlungen in Wien und den USA, darunter die persönliche Kunstsammlung des Unternehmers und Philanthropen Ronald S. Lauder, der die Neue Galerie mit ins Leben gerufen hat. Dass sie in dieser Auswahl gezeigt werden können, ist erst durch die enge Zusammenarbeit mit Dr. Paul Asenbaum möglich geworden, einem ausgewiesenen Experten für den Schmuck der Wiener Werkstätte.
Der Katalog Glanzstücke. Emilie Flöge und der Schmuck der Wiener Werkstätte, herausgegeben von Paul Asenbaum, Wolfgang Kos, Eva-Maria Orosz; Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart 2008, 152 Seiten, ist für 29 Euro im Museumsshop erhältlich.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Gerhart Frankl/Anton Kolig – Künstlerische Begegnungen
Aufgewachsen in Wien, wurde Gerhart Frankl durch seinen Vater, den Juristen Dr. Emil Frankl, der als Kunstsammler und Mäzen vor allem den Maler Anton Kolig förderte, bereits in seiner Jugend mit der Kunst konfrontiert. Nach Abbruch eines Chemiestudiums nahm Gerhart Frankl Anfang der 1920er Jahre Malunterricht bei Anton Kolig in Nötsch im Kärntner Gailtal. 1936 heiratete der Künstler Christine Büringer, eine Nichte des ebenfalls zum Nötscher Kreis zählenden Malers Sebastian Isepp. Diese biographischen Verbin-dungen bilden den Ausgangspunkt der diesjährigen Ausstellung Gerhart Frank/Anton Kolig - Künstlerische Begegnungen, die das Museum des Nötscher Kreises gemeinsam mit dem Gerhart Frankl Memorial Trust, London zusammenstellt. Im Mittelpunkt steht dabei das vielfältige Schaffen Frankls, das in einen Dialog zu wichtigen Werken Anton Koligs gesetzt wird. 1938 emigrierte Gerhart Frankl gemeinsam mit seiner Gattin Christine und setzte seine Malerei in England unter schwierigsten finanziellen Bedin-gungen fort. Die Kriegsereignisse verarbeitete er in eindrücklichen figurativen Szenen. Als Besonderheit gelten seine Alpenbilder und Aquarelle, die er während seiner Reisen durch Europa malte. In seinem Spätwerk fand Gerhart Frankl zu einer malerischen Bild-struktur, die bereits an der Grenze zur Abstraktion stand. Frankl gilt als einer der bedeutendsten Landschafts- und Stilllebenmaler sowie Graphiker der österreichischen Kunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Veranstaltungsvorschau: Gerhart Frankl/Anton Kolig – Künstlerische Begegnungen - Museum des Nötscher Kreises
Keine aktuellen Termine vorhanden!850 Jahre Stadt Sankt Pölten
Offizieller Mittelpunkt der Feierlichkeiten wird der 3. Mai sein. Dieser Tag, an dem 850 Jahre zuvor die Stadtrechtsurkunde durch Konrad II. von Passau ausgestellt wurde, wird mit einer gemeinsam von den Bischöfen der Diözesen Passau und Sankt Pölten gefeierten Festmesse im Dom sowie mit einem offiziellen Festakt im Landestheater begangen werden. Umrahmt werden diese Festlichkeiten von einem dreitägigen historischen Markt auf dem Rathausplatz (2. bis 4. Mai), der einen authentischen Einblick in die Lebensweise des Mittelalters geben und mit entsprechenden Attraktionen aufwarten wird.
Am 3. Mai erwarten den Besucher Sankt Pöltens aber auch bereits drei weitere Highlights des Jubiläumsjahrs. Zum einen ein Mittelalterrundgang durch Sankt Pölten, der auf die reiche, dem Besucher durch die zahlreichen baulichen Veränderungen der Barockzeit und der nachfolgenden Jahrhunderte oft verborgene mittelalterliche Vergangenheit dieser Stadt verweisen wird. Im Mittelalter bereits vorhandene Straßenzüge werden wieder ihre ursprünglichen Namen erhalten. Außerdem werden dem Besucher in Form von etwa 40 „in situ“ aufgestellten Schautafeln abgekommene oder später veränderte Gebäude, wo möglich dokumentiert durch historische Ansichten, vor Augen geführt. Parallel dazu erscheint eine den Rundgang dokumentierende Begleitbroschüre.
Erstmals ihre Pforten öffnen wird am 3. Mai auch die Diözesanmuseums-Ausstellung Sant Y poelten – Kloster und Stadt im Mittelalter. Im Mittelpunkt der Schau steht jenes spätmittelalterliche Kopialbuch, der Codex Pataviensis aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, das die Abschrift der Stadturkunde von 1159 bewahrt.
Die Ausstellung Stadt im besten Alter – 850 Jahre Stadt Sankt Pölten im Stadtmuseum, die ebenso wie die Ausstellung im Diözesanmuseum und die einige Tage später in der Niederösterreichischen Landesbibliothek zu eröffnende Ausstellung Sankt Pölten in alten Ansichten durch einen Katalog dokumentiert ist, wird sich in vielen Facetten, mitunter auch mit etwas Augenzwinkern, der Geschichte Sankt Pöltens nähern, wobei auch ein kurzer visionärer Ausblick in die Zukunft gewagt werden soll.
Dabei wird die Ausstellung des Stadtmuseums, die sich einleitend auch mit der Außensicht auf Sankt Pölten in den letzten Jahrhunderten auseinandersetzt, zwar nicht auf die Darstellung der für die Geschichte der Stadt elementaren Ereignisse verzichten und im Abschnitt „Local Heroes“ auch für die Stadtgeschichte bedeutende Persönlichkeiten wie Jakob Prandtauer oder Julius Raab erneut vor den Vorhang bitten; in gleicher Weise wird sie auch den Blick auf kleinere, oft unterschätzte, jedoch ebenso wichtige Ereignisse lenken oder den einen oder anderen bislang noch nicht gewürdigten Sankt Pöltner in den Mittelpunkt des Interesses rücken.
Etwa Rosl Lustig, die erste Maturantin des Sankt Pöltner Bubengymnasiums, die es als erstes Mädchen an der Schule dabei keineswegs leicht hatte, musste sie doch in der letzten Bank sitzen und vor jeder Stunde auf dem Gang auf den Professor warten, ehe sie die Klasse betreten durfte. 1938 musste sie vor den Nazis in die USA fliehen, wo sie unter ihrem späteren Namen Kubin als Professorin an verschiedenen Akademien und Highschools Karriere gemacht hat.
In Erinnerung gerufen werden aber auch unbekannte Sankt Pöltner Pioniere und Erfinder, wie etwa der Pionier des Radiowesens Dr. Karl Unger, der 1907 einen Apparat für drahtlose Telegrafie konstruierte und damit die erste ständige nicht militärische Sende- und Empfangsanlage auf dem Gebiet der österreichischen Monarchie schuf, oder der Sankt Pöltner Chefmechaniker Karl Cerny, der 1933 einen mit flüssigem Betriebsstoff angetriebenen Raketenwagen konstruierte.
Neben einer kurz gefassten einleitenden Stadtgeschichte mit umfassender Chronik und einem Überblick über die Stadtentwicklung, die auch durch eine Reihe historischer Beschreibungen, beginnend mit Braun-Hogenberg 1617 über die niederösterreichische Landaufnahme von 1791 und Schweickhardt bis hin zur kirchlichen Topografie von 1828 dokumentiert werden wird, werden in den Kapiteln „Katastrophen“ und „Sternstunden“ epochale Ereignisse der Stadtgeschichte, im Kapitel „Alltag und Festtag“ aber auch kleinere, fast unbedeutend scheinende Geschehnisse aus der reichen Geschichte in entsprechender Form präsentiert werden.
Im Kapitel „Absonderliches, Wissenswertes, Kurioses“ werden unter anderem Persönlichkeiten wie der Pottenbrunner Teufelsbündler Christoph Haitzmann oder der Sankt Pöltner Erfinder einer vereinfachten Rechtschreibung gewürdigt, der durch diese Maßnahme 80 Millionen Deutschen mindestens 36 Milliarden Kronen im Jahr ersparen wollte. Man wird in diesem Kapitel der Schau aber auch vom „Krieg mit Krems“, einem Manöver aus dem Jahr 1877, erfahren, bei dem das Regiment Hess bei Statzendorf gegen die Kremser Garnison kämpfte und bei dem von 1000 ausgerückten Soldaten am Abend nur noch 90 halbwegs unversehrt zurückkehrten, eine große Anzahl von ihnen aber überhaupt nicht mehr …
Kaum jemandem bekannt sein wird das Projekt eines Wiener Ingenieurs aus dem Jahr 1862, die Traisen nach Wien umzuleiten, oder dass Kaiser Wilhelm gemeinsam mit Otto von Bismarck 1873 von Kaiser Franz Joseph in Sankt Pölten willkommen geheißen wurde. Zum Schmunzeln anregen werden sicherlich Episoden wie jene über die erste Führerscheinprüfung in Sankt Pölten im Jahr 1906, die von über 30 Prüflingen in einem Wagen mit defektem Motor absolviert wurde, sodass dieser von Passanten angeschoben werden musste!
Ein eigenes Kapitel wird sich auch den bedeutenden Frauen der Stadtgeschich-
te, von Maria Antonia Montecuccoli, der Gründerin des Karmeliterinnenklosters, bis hin zu Maria Emhart, einer der Schlüsselfiguren im Februar 1934, widmen.
Einige der bedeutenden Frauen, die als Schülerinnen in Sankt Plöten weilten, wie etwa Enrica von Handel-Mazzetti, Paula von Preradovic´ oder die selige Maria Teresia Ledóchowska, werden im Kapitel „Schülerinnen und Schüler“ in den Mittelpunkt gerückt, zu denen unter anderem auch Persönlichkeiten wie Rainer Maria Rilke, Karl Seitz, Leopold Figl, aber auch Bernhard Paul und Manfred Deix zählen.
Ein Special wird auch den zahlreichen Gästen unserer Stadt, von Don Emanuel von Portugal über Napoleon, Mozart und Schubert bis hin zu Juri Gagarin, gewidmet. Ein weiterer Schwerpunkt befasst sich schließlich mit der reichen kulturellen Vergangenheit dieser Stadt, ehe die Sankt Pöltner Designuniversität ihre Zukunftsvisionen von Sankt Pölten präsentiert.
Stadt im besten Alter – 850 Jahre
Stadt Sankt Pölten
bis 1. November 2009 , Mi–So 10–17 Uhr
Stadtmuseum Sankt Pölten, Prandtauerstraße 2,
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Neue Ausstellung am Fuß des Kaiserbergs Hohenstaufen
Im „Staufer-Jahr“ 1977, in dem die im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart gezeigte Landesausstellung Die Zeit der Staufer alle Besucherrekorde brach, fand dieses Interesse an der Geschichte auch seinen Niederschlag in der Heimat der Staufer am Fuß des markant sich erhebenden Bergs Hohenstaufen. Es wurde die „Straße der Staufer“ als Kulturroute um den Hohenstaufen ausgeschildert und ein Ausstellungsraum erbaut. Seit 15. März 2009 wird dort die Geschichte der Staufer neu und ansprechend präsentiert.
Die Ausstellung nimmt die Herkunft und Heimat der Staufer zu ihrem Ausgangspunkt. Daran schließen sich Themen wie Ritter und Ministeriale, Barbarossa auf dem Kaiserthron, Staufer im Südreich und Kreuzzüge an. Die Ausstellung schildert aber auch den Wandel in Stadt und Land im 12. und 13. Jahrhundert, der erst das damalige Bevölkerungswachstum und die zahlreichen Stadtgründungen ermöglichte.
Fotos, Karten, Schaubilder, Originalzeugnisse und Nachbildungen bedeutender Kunstwerke der Stauferzeit veranschaulichen diese Aspekte. Zu sehen sind zum Beispiel die berühmte „Augustalis“-Goldmünze und Silbermünzen der Stauferzeit. Zu den beeindruckenden Nachbildungen gehören der Cappenberger Kopf mit der Taufschale Barbarossas und die Sitzfigur Kaiser Friedrichs II. vom Capuaner Brückentor. Hiezu wurden bereits in den 1960er-Jahren von den im Museum in Capua bewahrten Körperhälften und dem nur als Abguss erhaltenen Kopf weitere Abgüsse gemacht und diese wieder zur Gesamtfigur zusammengesetzt. Eine viel später von dem Kunsthistoriker Prof. Peter C. Claussen in der Vatikanischen Bibliothek entdeckte und mit Federico II betitelte Zeichnung bestätigte diese Rekonstruktion.
Zu sehen sind auch Nachbildungen von Urkunden, die auf dem Hohenstaufen ausgestellt worden sind. So hielt sich Kaiser Friedrich Barbarossa 1181 „in castro Stoufen“ auf. Und Königin Irene von Byzanz schrieb wenige Tage vor ihrem Tod in der Burg der Vorfahren ihres Gatten Philipp von Schwaben in bewegenden Worten ihren Letzten Willen nieder. Auf Flachbildschirmen laufen Kurzfilme, die von Barbarossa auf dem Kreuzzug und den Frauen der Staufer handeln, aber auch die Rüstung eines Kreuzritters und seinen Umgang mit Schwert und Schild anschaulich machen.
Die Texte und Erläuterungen in der Ausstellung sind durchgängig in Deutsch, Englisch und Italienisch zu lesen, auch die Filme sind dreisprachig abrufbar. Die Ausstellungsgestaltung lag in den Händen von Ranger Design, Stuttgart.
Vom Ausstellungsraum erreicht man den Gipfel des Hohenstaufen mit der Ruine der staufischen Stammburg in 15 Minuten. Vom Gipfel des kegelförmigen Zeugenbergs bietet sich ein wunderbarer Panoramablick.
Die Staufer
Dauerausstellung im Dokumentationsraum für staufische Geschichte, Kaiserbergsteige 22,
D-73037 Göppingen-Hohenstaufen
bis 15. November, Di–So 10–12 und 13–17 Uhr; in der Winterzeit Sa und So zu denselben Zeiten. Der Eintritt ist frei.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.






























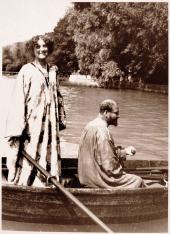

















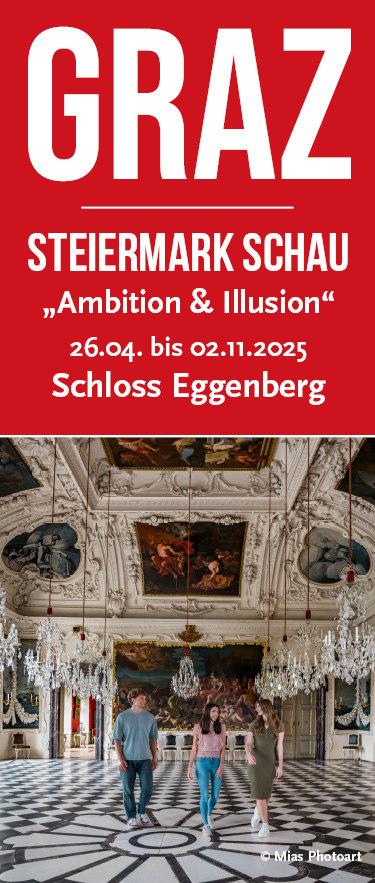







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.