Ausstellung
Kunst kennt keine Grenzen
„Nationale, sprachliche oder gar kulturelle Grenzen gibt es beim Atelier an der Donau nicht“, erklärt der künstlerische Leiter des Symposiums, Atanas Kolev. Zehn Tage lang leben und arbeiten rund 30 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt in Pöchlarn, direkt an der Donau, zusammen: „Das umgebaute Lastschiff Negrelli und der letzte Donauraddampfer, die Schönbrunn, ankern an der Donaulände direkt im Zentrum von Oskar Kokoschkas Geburtsstadt und sind einzigartiges Atelier und Treffpunkt für die Künstlerinnen und Künstler und die Interessierten“, so Kolev. Die Maler(innen), Grafiker(innen) und Bildhauer(innen) tragen die Idee von Kunst, die über alle Grenzen hinweg Menschen verbindet, hinaus in die große, weite Welt – und quasi als Gastgeschenk lassen sie ihre Kunstwerke in Pöchlarn. „Der Verein Atelier an der Donau lässt diese aber nicht in einem dunklen Abstellraum verstauben, sondern ermöglicht Kunstinteressierten den Blick auf die moderne und zeitgenössische Kunst auf höchstem Niveau: bei Wanderausstellungen in ganz Europa – beispielsweise in Rumänien, Italien, Deutschland oder Tschechien.“
Kunst als völkerverbindendes Element
„Die Menschen stehen sowohl einem offenen Europa als auch der modernen Kunst oft skeptisch gegenüber“, meint der Organisator des Events, Gerhard Maller. „Unser Verein möchte zeigen, dass Grenzenlosigkeit durchaus auch positive Aspekte haben kann: durch die Begegnung mit Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund und eine andere Art zu leben haben, aber dennoch sympathisch und liebenswert sind.“ Das Kennenlernen von Kunst aus den verschiedensten Ländern soll aber nicht nur Kunstinteressierte ansprechen, sondern auch Verantwortungsträger(innen) aus Politik und Wirtschaft: „Denn als Partner und Sponsoren sind diese nicht wegzudenken, ohne sie würde es Kunstförderung gar nicht geben“, meint Maller. „Sie helfen uns durch die Unterstützung unseres Projekts, die Kommunikation innerhalb Europas zu verbessern.“ Zudem wollen die engagierten Mitglieder des Vereins Atelier an der Donau maßgeblich dazu beitragen, die Stadt als Kulturstadt zu etablieren und so der Region zu mehr Wertschöpfung zu verhelfen: „Unsere Ziele sind sehr visionär, und wir haben noch eine lange, harte Zeit vor uns. Aber wir sind auf dem besten Weg, unsere Ziele zu verwirklichen“, freut sich Gerhard Maller, der den stetigen Kontakt zu den Sponsoren pflegt.
Das Symposium als Schnittstelle zwischen Künstler(inne)n und Interessierten
Bereits zum vierten Mal findet in diesem Jahr das internationale Symposium „Atelier an der Donau“ statt. Vom 2. bis 12. September machen 30 Maler(innen), Grafiker(innen) und Bildhauer(innen) die Nibelungenstadt zu einem künstlerischen Zentrum. „Wir wollen, dass dieser Termin zu einem Fixpunkt für die Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt wird“, setzt sich Atanas Kolev ein Ziel. „Und inzwischen nehmen auch schon viele Interessierte mit uns Kontakt auf, weil sie an diesem Symposium teilnehmen wollen.“ Bisherige Teilnehmer(innen) waren zum Beispiel der in Österreich lebende Zypriote Stylianos Schicho, Roman Zaslonov (Belarus, Frankreich), Imre Keri (Ungarn), Aculina Strasnei Popa (Rumänien) und der Österreicher Georg Brandner.
Sie lockt nicht nur das Preisgeld von 5000 Euro je Sparte, erklärt Organisator Gerhard Maller. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Geld bei den Künstlerinnen und Künstlern nicht im Vordergrund steht. Sie legen Wert auf ein entspanntes, freundschaftliches Ambiente – während des Symposiums sind wir alle eine große Familie: die Mitglieder des Vereins, die Künstlerinnen und Künstler und die Kunstinteressierten. Und das macht das Atelier an der Donau unverwechselbar und liebenswert!“
Museumsreif: Geschichten über 1000 Jahre Kulturlandschaft Sachsens
An die 500 Museen breiten in Sachsen ihre gesammelten Schätze kunstvoll aus. Mit dieser stattlichen Vielfalt nimmt der Freistaat einen der vordersten Plätze in Deutschland ein. Zu den bedeutendsten Museen der Welt zählen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit ihren insgesamt elf Museen. 2010 feiern sie ihr 450. Jubiläum. Sie sind in ihrer thematischen Vielfalt einmalig. Ihren musealen Ursprung haben sie in den barocken Sammlungen der sächsischen Kurfürsten und polnischen Könige August der Starke und seines Sohns König August III.
Die „Türckische Cammer“ zu Dresden ab Dezember 2009
Ein neuer Schatz kommt im Dezember hinzu: Die „Türckische Cammer“ zu Dresden – die kurfürstlich-sächsische Sammlung orientalischer Kunst im Dresdner Residenzschloss. Auf 750 Quadratmetern präsentiert sie nicht weniger als 1000 Objekte. Größtes Objekt ist ein knapp 20 Meter langes und 6 Meter hohes osmanisches Staatszelt mit prächtigen Applikationen aus Seide und vergoldetem Leder. Eine andere Besonderheit der Sammlung sind die erhaltenen historischen Inventare. Das älteste stammt aus dem Jahr 1606. Die Sammlung ist in ihrem Erhaltungszustand und in dieser Größe so nur in Dresden erlebbar. Die „Türckische Cammer“ der Kurfürsten von Sachsen erhält damit nun endlich eine Ausstellungsmöglichkeit, wie sie ihrer internationalen Bedeutung gerecht wird.
Das neue Albertinum – Haus der Moderne ab Juni 2010
Ein weiteres Ereignis von Weltrang steht in Dresden 2010 bevor: die Wiedereröffnung des Albertinums nach mehrjährigem Umbau mit der Galerie Neue Meister und der Skulpturensammlung. Eine schwebende Brücke über dem Innenhof macht das Albertinum an der Brühlschen Terrasse dann schon von außen spektakulär. In der Galerie Neue Meister wird in den sanierten Ausstellungsräumen die Kunst der Moderne ab dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart in neuem Ausmaß, neuer Zusammenstellung und in all ihren Gattungen gezeigt. Im Mittelpunkt stehen Werke von Künstlern aus Dresden und der Region.
www.skd-dresden.de
Neo Rauch im Museum der bildenden Künste Leipzig
Und wenn es heute gilt, über die Kunst in Leipzig zu berichten, dann steht ein Name im Vordergrund: Neo Rauch. 2010 feiert der Künstler der Neuen Leipziger Schule seinen 50. Geburtstag. In einer großen Überblicksausstellung vom 18. April bis 8. August 2010 im Museum der bildenden Künste zieht er Resümee. Neben einigen frühen Werken mit zentraler Bedeutung für den Künstler zeigt die Ausstellung in Leipzig und fast parallel in der Pinakothek der Moderne München mehr als 90 Bilder, die nach 2006 entstanden sind und bisher noch nie gezeigt wurden. Das Museum der bildenden Künste zählt zu den ältesten Kunstmuseen Deutschlands und ist auf die bürgerliche Sammelleidenschaft im 19. Jahrhundert zurückzuführen.
www.mdbk.de
Ein kostbarer Koromandel-Lackschirm im GRASSI-Museum
Auch Leipzig hat mit dem umfassend sanierten GRASSI-Museum für angewandte Kunst ein Juwel zu bieten. Die neu konzipierte ständige Ausstellung soll künftig insgesamt drei Ausstellungsrundgänge umfassen. Der erste, bereits zu besichtigende Rundgang, „Antike bis Historismus“, erstreckt sich über 30 Ausstellungsräume. Er lädt zu einer Reise durch 2500 Jahre Kunstgeschichte ein. Der zweite Ausstellungsrundgang, „Asiatische Kunst“, eröffnet im November 2009 mit Kunsthandwerk vor allem aus China, Japan und Persien. Zu den Glanzstücken der „Asiatischen Kunst“ zählt neben zahlreichen, seit Jahrzehnten nicht mehr zugänglichen Einzelobjekten ein kostbarer Koromandel-Lackschirm. Die Eröffnung des dritten Rundgangs, „Jugendstil bis Gegenwart“, ist für Herbst 2011 vorgesehen. Darüber hinaus locken wechselnde Sonderausstellungen und die jährlich Ende Oktober stattfindende GRASSIMESSE, eine der europaweit bedeutendsten Verkaufsmessen für angewandte Kunst und Design, ins Museum für angewandte Kunst.
www.grassimuseum.de
„Noble Gäste“ in den Kunstsammlungen Chemnitz
In Chemnitz bilden die Kunstsammlungen mit zahlreichen Werken Karl Schmidt-Rottluffs und das Museum Gunzenhauser unter dem Namen Kunstsammlungen Chemnitz – Museum Gunzenhauser einen unübersehbaren Schwerpunkt der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts in Sachsen. Die Kunstsammlungen Chemnitz feiern 2009 ein besonderes Jahr, denn das Gebäude auf dem Theaterplatz wird 100 Jahre alt. Zum Reigen besonderer Ereignisse gehören Ausstellungen mit Werken von noch nie beziehungsweise selten in Deutschland präsentierten Künstlern wie Henri Le Sidaner und Aristide Maillol. An der Präsentation von Dänemark in Sachsen sind die Kunstsammlungen Chemnitz mit Skulpturen eines der bedeutendsten lebenden Bildhauer des Landes, Bjørn Nørgaard, beteiligt. Ein weiterer Anlass für Neuigkeiten ist der 125. Geburtstag von Karl Schmidt-Rottluff in diesem Jahr. Mit fünf bedeutenden Gemälden des Malers Lovis Corinth beherbergen die Kunstsammlungen seit Januar 2009 „noble Gäste“ aus der Kunsthalle Bremen.
Der 40. Todestag von Otto Dix steht von Mai bis Oktober dieses Jahres im Museum Gunzenhauser im Mittelpunkt. Dix gilt als der wichtigste Künstler der privaten Sammlung deutscher Kunst des 20. Jahrhunderts, die der Münchner Galerist Dr. Alfred Gunzenhauser der Stadt im Jahr 2003 stiftete. Hiefür wurde das 1930 fertiggestellte Sparkassengebäude zu einem Kunstmuseum umgebaut, das Architektur und Sammlungsprofil hervorragend vereint. Die Stiftung umfasst mehr als 2400 Werke von 270 Künstlern, darunter mit 290 Werken eines der weltweit größten Otto-Dix-Konvolute. Diese einzigartige Sammlung von Weltformat ist eine unschätzbare Bereicherung, die weit über Chemnitz hinaus ihre Wirkung entfaltet.
www.kunstsammlungen-chemnitz.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Wiedereröffnung der Krypta der Stiftskirche in Quedlinburg
Die Krypta der Stiftskirche Sankt Servatii in Quedlinburg gehört zu den schönsten Räumen dieser Art in ganz Europa. Sie entstand im Zuge des Neubaus der Kirche zwischen 1070 und 1129 unter Einbeziehung älterer Bauteile. So greift ihr Ostteil vermutlich den Grundriss der Pfalzkapelle Heinrichs I. auf, und auch die im Apsisbereich gelegene Confessio mit reichem Stuckdekor entstand bereits im 10. Jahrhundert.
Krypten waren historisch Orte des Totengedenkens und der Reliquienverehrung. Als gesonderte Räume mit kapellenartigem Charakter nahmen sie vielfach die Gräber besonders verehrter Persönlichkeiten auf. Die Krypta der Stiftskirche Sankt Servatii in Quedlinburg birgt die Grablegen König Heinrichs I. († 936) und seiner zweiten Gemahlin, Mathilde († 968). Mit der Grablegung Heinrichs in Quedlinburg aufs Engste verbunden war die Gründung eines Kanonissenstifts auf dem Burgberg, dem heutigen Schlossberg, durch die Königinwitwe Mathilde bereits wenige Wochen nach dem Tod Heinrichs. Dieses Stift wurde nicht nur zu einem wichtigen Ort des Totengedenkens an Heinrich I., sondern auch zu einem Ort der Heilssorge der Gründer und der Gründerfamilie und zu einer wichtigen Bildungseinrichtung für Kinder aus dem Hochadel.
Die Krypta der Stiftskirche ist eine geräumige Hallenkrypta mit reichem Bauschmuck. Neben den Grablegen des Herrscherpaars birgt sie eine Reihe wertvoller Äbtissinnengrabplatten und einzigartige spätromanische Gewölbemalereien. Die ältesten Grabplatten entstanden bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Sie zeigen die Verstorbenen – Kaisertöchter, die dem Stift als Äbtissinnen vorstanden (un-
ter anderen Beatrix I., eine Tochter Heinrichs III.) – als Ganzfiguren und gehören damit zu den ältesten überkommenen ganzfigurigen Grabplatten in Europa überhaupt.
Auch die Gewölbemalereien entstanden bereits im 12. Jahrhundert und zählen damit zu den ältesten überlieferten Wandmalereien in Deutschland. Dargestellt sind Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament, außerdem einzelne Heilige und historische Persönlichkeiten, darunter ein Bischof und eine männliche Herrschergestalt, letztere inschriftlich als „Otto Magnus“ bezeichnet. Der umfangreichste erhaltene Bildzyklus berichtet von Susanna, einer vorbildhaften, gottesfürchtigen und Gott vertrauenden Frauengestalt des Alten Testaments, und umfasst allein zehn Bildfelder.
Wegen großer Schäden an den Gewölbemalereien musste die Krypta 2002 für Besucher geschlossen werden. Bereits 2001 begannen im Rahmen eines Forschungsprojekts der Hochschule für bildende Künste in Dresden umfangreiche Zustandserfassungen. Sie bildeten die Grundlage für ein von der Hochschule entwickeltes Konservierungskonzept, das in den Folgejahren umgesetzt wurde.
Nach weiteren vom Land Sachsen-Anhalt und der Lotto-Toto GmbH Sachsen- Anhalt geförderten Maßnahmen, zu denen Sicherungsarbeiten an den ottonischen Stuckelementen der Confessio, die Installation einer neuen Beleuchtung und die Reparatur des Ziegelbodens gehören, wurde die Krypta am 14. März 2009 feierlich wiedereröffnet. Sie ist jetzt für Besucher der Stiftskirche erneut zugänglich, aus konservatorischen Gründen vorerst allerdings nur für 30 Gäste stündlich (Anmeldung über den Besucherdienst empfehlenswert).
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Ein besonderer Ort der Kunst in Ostbayern
Das Kunstmuseum widmet sich herausragenden Künstlerpersönlichkeiten, die in den signifikant deutsch geprägten Kulturräumen im heutigen östlichen Europa aufgewachsen sind oder gewirkt haben. Es sammelt und präsentiert aber auch zeitgenössische Kunst aus den ostmittel- und südosteuropäischen Nachbarländern.
Unter dem Leitmotiv „Erinnerung & Vision“ öffnet eine bundesweit einzigartige Spezialsammlung den Blick auf deutsche Kunst im östlichen Europa von der Romantik bis zur Gegenwart. In 15 starkfarbigen Themenräumen überraschen Werkkomplexe von Lovis Corinth, Käthe Kollwitz und Adolf Hölzel sowie Hauptwerke von Adolph von Menzel, Oskar Kokoschka und Lyonel Feininger oder Sigmar Polke, Gerhard Richter und Katharina Sieverding.
Sonderausstellungen im Spannungsfeld von klassischer Moderne und osteuropäischer Gegenwartskunst locken ein überregionales Publikum nach Regensburg. Mit Kooperationen und Künstlerprogrammen, Konzerten und Veranstaltungen im Bereich Jazz, Neue Musik und Tanz sowie vielfältigen Kunstvermittlungsangeboten für Jung und Alt versteht sich das Kunstforum als Vermittler zwischen Ost und West und als Forum der Begegnung der Generationen, Künste und Epochen.
Sonderausstellungen 2009
Schmidts Fotoalbum. Arno Schmidt als Fotograf
Farbabbildungen und Schwarzweißfotografien des bedeutenden Schriftstellers (1914–1979), den seine in Schlesien verbrachte Kindheit und Jugend entscheidend prägte.
bis 1. Juni 2009
Corinth auf Papier. Die Regensburger Sammlung
Erstmalige Präsentation der Regensburger Corinth-Sammlung an Zeichnungen und Druckgrafiken. Ein Blick in die intimsten Werkgeheimnisse des Grenzgängers zwischen allen Stilen.
bis 17. Mai 2009
Paul Kleinschmidt. Lust an der Malerei
Blick auf das großstädtische Milieu von Bar, Café, Zirkus und Boudoir der 20er- und 30er-Jahre. Vor allem Werke aus süddeutschem Privatbesitz würdigen den von Künstlerkollegen hoch geschätzten „proletarischen Rubens“.
20. Juni bis 30. August 2009
Labor IV: „Perfect Asymmetry“. Zeitgenössische Kunst aus der Slowakei
Positionen junger Kunst der Slowakei. In Malerei, Video und Installation reflektieren zeitgenössische Künstler den politischen Wandlungsprozess ihres Heimatlands. Eine Kooperation mit der donumenta 2009.
20. September bis 8. November 2009
Kaleidoskop. Hœlzel in der Avantgarde
Highlight des Ausstellungsjahrs 2009: umfassende Retrospektive zu Adolf Hölzel (1853–1934) – Wiederentdeckung einer Zentralfigur der Sammlung im Horizont der Avantgarde.
29. November 2009 bis 28. Februar 2010
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Mahlzeit! – Genuss und Kunst des Essens
Das Erfolgsgeheimnis oberösterreichischer Landesausstellungen liegt in der Auswahl attraktiver Standorte und interessanter Themen, verbunden mit der Präsentation hochkarätiger Originalobjekte vor dem Hintergrund einer spannenden Inszenierung. Das Zisterzienserstift Schlierbach im Kremstal mit seiner langen Tradition und der Gemeinschaft des Zusammenlebens ist ein idealer Austragungsort für diese Landesausstellung. Dass die Kulinarik in diesem Ambiente nicht zu kurz kommt, dafür bürgt nicht nur das Image des Klosters als Käsezentrum, sondern auch die Einbettung in die Genussregion des Landes.
Der Rundgang durch die Landesausstellung Mahlzeit! beginnt im prunkvoll barocken Bernardisaal, von wo aus sich den Besuchern Blicke auf die Tischkultur verschiedener Epochen, Länder und Kontinente eröffnen. Eine kritische Auseinandersetzung mit unseren Essgewohnheiten ist in weiterer Folge ebenso Teil des Ausstellungsrundgangs wie verschiedene Inszenierungen zur Tradition und Erzeugung heimischer Nahrungsmittel – allen voran der Kartoffel, des Krauts, aber auch von Most, Bier und vielem anderen mehr.
Anschließend begeben sich die Besucherinnen und Besucher weiter in Richtung Schaukäserei, in der das Geheimnis der Herstellung von Europas wahrscheinlich bestem Rotschimmelkäse gelüftet wird.
Die historische Stiftsbibliothek hingegen ist wieder einer jener barocken Prunkräume, in denen – in einer Verbindung aus kostbaren Originalexponaten und spannender Inszenierung – so manch jahrhundertelang tradiertes Wissen zum Thema Essen und Trinken vermittelt wird.
Auch die beeindruckende Stiftskirche des Klosters Schlierbach ist in den Ausstellungsrundgang eingebunden, genauso wie die Sakristei, die Werktagskapelle, der Kreuzgang und das Refektorium. In diesen Räumlichkeiten wird Gelegenheit zur Ruhe und Besinnung geboten, aber auch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Fragen „Wie verhält es sich weltweit mit Hunger und Überfluss?“, „Wie steht es mit Not und Vergeudung?“, „Wie sieht es mit der Zukunft des Essens aus?“, „Werden uns die Nahrungsmittel ausgehen“ oder „Was wird die Produktion hochwertiger Nahrungsmittel künftig kosten?“. All das sind Fragen, auf welche die Landesausstellung in Schlierbach eine Antwort zu geben versucht.
Integriert in den Ausstellungsrundgang ist auch diesmal wieder eine eigene Vermittlungsschiene. Entlang dieser Vermittlungsschiene erschließt sich vor allem Kindern, Jugendlichen und Familien das Ausstellungsthema auf besonders anschauliche und einprägsame Weise. Darüber hinaus können auch für Schulklassen spezielle pädagogische Begleitprogramme gebucht werden.
29. April bis 2. November 2009, 9 bis 18 Uhr
Stift Schlierbach
Essen und Trinken genießen.
Das Veranstaltungsprogramm zur Landesausstellung
Die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens allein in einer Ausstellung zu dokumentieren macht wenig Sinn. Aus diesem Grund gibt es – begleitend zur heurigen Landesausstellung Mahlzeit! – ein umfassendes Veranstaltungsprogramm. Hier ein erster Überblick:
Die Koch- und Gourmetveranstaltungen mit Spitzenköchen aus Österreich finden meist dienstags statt und präsentieren unter anderem bekannte Namen wie Johann Lafer, Elisabeth Grabmer, Toni Mörwald, Lisl Wagner-Bacher oder Johanna Maier. Jeden Donnerstagabend bieten die „Genussgelegenheiten“ die Möglichkeit, regionale Produkte wie Käse, Most, Wein, Bier, Geflügel und so weiter zu verkosten.
„Selbst gemacht schmeckt’s am besten“ heißt es vor allem an den Wochenenden, wenn man sich im Käsg’wölb des Stifts seinen eigenen Käse oder das eigene Brötchen herstellen kann.
Die Veranstaltungsreihe „Genuss & Kunst“ findet jedes Wochenende statt und verbindet jeweils den kulinarischen Genuss mit einem Element aus den Bereichen Musik, Kabarett oder Literatur. Dabei wird man beispielsweise Karl Merkatz mit dem Blunznkönig erleben, Prof. Christoph Wagner bei einer Lesung hören oder Aufstriche bei den Klängen des Anton-Bruckner-Streichquartetts selbst aufs Brötchen streichen.
Stift Schlierbach Genusszentrum
Tel. (+43-75 82) 83 0 13
www.stift-schlierbach.at
Kartenverkauf in allen oberösterreichischen Raiffeisenbanken
Weitere Möglichkeiten
„Genuss-Tage“: An vier verlängerten Wochenenden wird man im Stiftsinnenhof jeweils von Donnerstag bis Sonntag Konditoren, Bäckern und anderen Lebensmittelproduzenten beim Produzieren zuschauen und die Ergebnisse natürlich auch vor Ort verkosten können.
Der Dunkelgenussraum lädt ein, um jeden Samstagnachmittag seinen Kaffee oder andere Köstlichkeiten im Dunkeln zu genießen, was natürlich auch für Kinder sehr interessant ist.
Zusätzlich kann man im Lebens-Ernährungs-Parcours jeden Mittwoch bis Sonntag jeweils am Nachmittag Infos über Nahrung für Körper, Geist und Seele holen. In diesem Zusammenhang wird es auch zahlreiche Vorträge geben.
SPES Zukunftsakademie Schlierbach
Tel. (+43-75 82) 82 1 23-43
www.spes.co.at
Wochenend-Erlebnisprogramm für Familien und Kinder zu landwirtschaftlichen Themen
Jedes Wochenende freier Eintritt, zum Beispiel Geflügel, Ziege, Kräuter, Erdbeeren, Spargel, Milch, Grillen, Most, Nuss. In Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Oberösterreich jeden Samstag und Sonntag Kulinarisches aus der Genussregion Schlierbacher Geflügel.
Landwirtschaftliche Fachschule Schlierbach
Tel. (+43-75 82) 81 2 23 oder 81 0 17
www.landwirtschaftsschule.at
www.schlierbacher-gefluegel.at
www.landesausstellung.at
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Gefangen im Bernstein
Bernstein, das ausgehärtete Harz fossiler Bäume, ist der Öffentlichkeit hauptsächlich als Schmuckstein bekannt. Für die Wissenschaft ist er jedoch vor allem deshalb von großem Interesse, da das noch flüssige Harz beim Austreten aus dem Baum die in dem Bernsteinwald vorkommenden Pflanzen und Tiere eingeschlossen und somit nahezu unverändert überliefert hat. Diese Einschlüsse von Organismen, sogenannte Inklusen, sind dreidimensional und im feinsten Detail erhalten, sodass die etwa 50 Millionen Jahre alten Pflanzen und Tiere im baltischen Bernstein wie lebendig aussehen.
Darüber hinaus sind, gleich uralten Momentaufnahmen, auch das Verhalten einzelner Tiere sowie Interaktionen zwischen verschiedenen Arten zu beobachten. So zeigen sich verschiedene Insekten, die häufigsten Fossilien im Bernstein, bei der Paarung, der Eiablage oder beim Schlüpfen, während parasitische Milben Zikaden befallen, Moosskorpione an den Beinen einer Fliege per Anhalter reisen und Ameisen mit ihren Fühlern Blattläuse betrillern, um diese zum Ausscheiden des nahrhaften Honigtaus zu bewegen.
Die Bernstein-Ausstellung im Biologiezentrum profitiert von einer Kooperation mit der Partnerkulturhauptstadt Vilnius. Die Sammlungen in Litauen, wo der baltische Bernstein zutage tritt, zählen zu den größten der Welt und werden in Linz einmalige Schaustücke mit Szenen aus dem Bernsteinwald zeigen.
bis 18. Oktober 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Neuer Südtrakt für das Linzer Schloss
Nach vielen Diskussionen, Überlegungen und Planungen ist es im Hinblick auf das Kulturhauptstadtjahr 2009 gelungen, ein zukunftsweisendes Museumsprojekt für Oberösterreich zu realisieren: einen neuen Südtrakt für das Linzer Schloss, der an den historischen Schlossbau anknüpft. Mit der Wiedererrichtung des um 1800 abgebrannten Südflügels des Linzer Schlosses entsteht über den Dächern der Stadt ein Ensemble aus historischer und moderner Architektur, das größte Universalmuseum Österreichs an einem Ort. Dieses Oberösterreichmuseum, das mit seinen Sammlungen einen fundierten und breiten Überblick der gesamten Natur-, Kultur- und Kunstgeschichte von der Ur- und Frühgeschichte bis ins 21. Jahrhundert im Raum Oberösterreich gibt, ist auch Mittelpunkt eines öffentlichen Kultur- und Begegnungsraums: ein Ort mit optimalen Voraussetzungen für Konzerte, Diskussionsforen und Kulturveranstaltungen jeder Art, aber auch ein Ort, an dem man sich einfach nur trifft und austauscht, Kulinarisches aus Oberösterreich ebenso genießt wie einen herrlichen Blick auf die Stadt und ihr Umland. Wer Kontemplation und Muße sucht, wird im neu gestalteten Schlosspark fündig werden, den Innenhof mit Biotop als Ausschnitt der oberösterreichischen Naturlandschaften und ihrer Artenvielfalt genießen und den restaurierten Schlossbrunnen als Ruheanker spüren.
Eine schwebende stählerne Brücke über der Stadt
Aus dem europaweiten Architekturwettbewerb ging Anfang März 2006 das junge Grazer Architektenteam HoG (Martin Emmerer, Hansjörg Luser und Clemens Luser) als Sieger hervor. Der neue Zubau nimmt Kubatur und Lage seines historischen Vorgängers auf, ohne jedoch den Museumshof wieder völlig abzuschließen. Während sich drei Ausstellungs- und Funktionsgeschosse hinter der mächtigen Befestigungsmauer verbergen, scheint der von der Stadt aus sichtbare Baukörper über der Festungsmauer zu schweben – einer auf nur zwei Kernen lagernden, frei auskragenden Brücke gleich. Die transparente äußerste Hülle besteht aus grobmaschigem Streckmetall, dahinter befinden sich Glas- oder Massivwände. Zur Optimierung des Energiehaushalts wurde das gesamte Schloss, das heißt auch der Altbau, einer beleuchtungstechnischen Generalsanierung unterzogen und ein neues Beleuchtungskonzept entworfen, das modernen ästhetischen Anforderungen gerecht wird. Die Ostfassade des neuen Südtrakts wird als Medienfassade ausgebildet. Direkt in die Streckmetallfassade des Obergeschosses integriert, ermöglicht das neuartige System, digitale Bildwelten als Bestandteil der Museumsfront wahrzunehmen. Prof. Günther Selichar von der Kunstuniversität Leipzig hat für diese Fassade ein spezielles Kunst-am-Bau-Projekt entwickelt, das eine interaktive Steuerung der digitalen Bildwelten durch jeden Interessierten über Handy oder Internet ermöglicht.
Neue Dauerausstellungen Natur und Technik Oberösterreich
Der moderne Zubau aus Stahl und Glas bietet auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern Raum für die beiden Dauerausstellungen Natur und Technik Oberösterreich, einen modernen Sonderausstellungsraum sowie ein großzügiges Entree mit Museumsshop, Terrasse und Restaurant. Ein eleganter Veranstaltungsraum bietet einen fantastischen Ausblick über die Dächer der Linzer Innenstadt.
Im neuen Südtrakt wird erstmals das publikumsattraktive Thema Natur in Form einer Dauerausstellung präsentiert. Lebensraumdarstellungen mit erstklassigen Präparaten, Modelle von Weltklasse, kombiniert mit lebenden Tieren in Aquarien, und neueste Technik garantieren ebenso abwechslungsreiche wie informative Museumsstunden. Die neue Dauerausstellung Technik Oberösterreich erzählt spannende Geschichten über die Astronomie sowie die Technik-, Industrie-und Wirtschaftsgeschichte Oberösterreichs. Darüber hinaus präsentiert die Ausstellung mit dem Museum Physicum, einer Sammlung von physikalischen Lehrmitteln des 18. und 19. Jahrhunderts, eine besondere Rarität. Im neuen Sonderausstellungsraum, der konservatorisch, klima- und sicherheitstechnisch den höchsten internationalen Standards gerecht wird, können Ausstellungen mit hochkarätigen internationalen Objekten gezeigt werden.
Das grüne Band Europas:
Grenze.Wildnis.Zukunft
Ganz bewusst wurde für die erste Präsentation im neuen Museumsensemble ein Thema mit europapolitischer Perspektive gewählt, ein Thema das auch für Oberösterreich von spezieller Bedeutung ist: Das Projekt Das grüne Band Europas wird im Sommer des Kulturhauptstadtjahrs eröffnet und ist eine Kooperation der Oberösterreichischen Landesmuseen mit Linz09, dem Oberösterreichischen Landesarchiv, der Oberösterreichischen Naturschutzakademie und NGOs (zum Beispiel der Internationalen Naturschutzunion IUCN und dem Österreichischen Naturschutzbund).
Das grüne Band Europas verbindet die Erhaltung von wertvollen Naturgebieten entlang dem ehemaligen Eisernen Vorhang von Skandinavien bis zur Türkei mit dem Schicksal der dort lebenden Menschen und nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten. Daraus ergibt sich eine konsequente Verknüpfung von Naturgeschichte und Zeitgeschichte mit Schicksalen lokaler Naturgebiete und Zeitzeugen. Die Ausstellung arbeitet historische und aktuelle Probleme sowie Zukunftsaussichten auf und stellt sie in den Kontext „von der Todeszone zum Band des Lebens“.
4. Juli 2009 bis 8. Januar 2010
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Q wie Quelle
Der Kärntner Künstler Werner Hofmeister schuf mit dem Museum für Quellenkultur in Klein Sankt Paul einen „Andachtsort“ von hoher Spiritualität für radikale Mystiker. Hofmeister ist auf der Suche, der quête, nach dem Q. Und er ist im Übermaß fündig geworden: prähistorische Werkstücke, Steinzeichnungen und Skulpturen, keltische Bodenfunde aus Kärnten, mittelalterliche Tafelbilder, das Logo der Firma Quelle, die Struktur einer Monstranz, der „Schein“ auf zahllosen Kärntner Kirchtürmen – aus 1000 optischen Eindrücken quillt ihm das Q in seine Arbeit hinein.
Das Q als Thema mit im Wortsinn unendlichen Variationen: Fundstücke und künstlerische Aufarbeitung über das Q sind im Museum für Quellenkultur dokumentiert, das Hofmeister eingerichtet, das er mit einem dem Q gewidmeten Skulpturenpark umgeben hat und ständig erweitert. So finden sich in dem sorgfältig restaurierten Gebäude eines alten Hammerwerks volkskundliche Exponate, eine Sammlung aus Andachtsbildern (aus 200 Jahren, kontrastiert mit solchen aus eigener Produktion oder von zeitgenössischen Kärntner Künstlern), Firmenlogos und Installationen.
Kunsthaus kärnten:mitte
Im Kunsthaus von Werner Hofmeister fallen Herberge und Beherbergtes zusammen. Wie eine Einsiedelei, wie ein „Walden“ im Görtschitztal. Kein Bett, kein Stuhl, kein Tisch. Eine Laterne von Weitem in der Nacht.
Bilder verdichten sich, werden durchlöchert von Texten, diese durchlöchern neue Bilder, nachdem sie zu dicht geworden sind, zu dicht für den Blick auf die Welt.
Die Zeichen mutieren in dieser Häufung zum Ornament, zu einem Gemurmel, das diejenigen, welche das Kunsthaus betreten, umgibt, wie das Rauschen eines Baches.
Als wollte der Künstler jeweils ein Zeichen, eine Form wieder durch Wiederholung tilgen. Wiederholung des Wortes, bis es seine Bedeutung verliert, seinen Sinn und nur noch als Spur das Universum markiert.
(Auszüge aus: Hubert Matt, „Zum Kunsthaus von Werner Hofmeister“)
Programm 2009
Eröffnung kunsthaus kärnten:mitte
Tanzperformance von Marina Koreimann
Musik von Jannis Xenakis.
6. Juni 2009, 16 Uhr
Museum Schule
Kinder zeichnen das Kunsthaus.
27. September 2009
Freiluftkino beim Kunsthaus:
Der Kinoleinwandgeher
Ein Film von, mit und über Josef Winkler.
Sommer 2009
Informationen
Museum für Quellenkultur im Talmuseum Lachitzhof, A-9373 Klein Sankt Paul
Juli bis Oktober: So 10–17 Uhr
Kunsthaus & Skulpturenpark
ganzjährig geöffnet
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Toulouse-Lautrec: Der intime Blick
Im Rahmen von Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas präsentiert die Landesgalerie Linz am Oberösterreichischen Landesmuseum die europäische Künstlerpersönlichkeit Henri de Toulouse-Lautrec. Auf die „europäische Dimension“ dieses Ausstellungsprojekts verweisen auch die Grundüberlegungen des kuratorischen Konzepts: Im Sinne des Ausstellungstitels fällt der „intime Blick“ Henri de Toulouse-Lautrecs auf eine Bildwelt, der in ihrer formalen und ikonografischen Umsetzung eine Schlüsselfunktion für die Etablierung der modernen Kunst am Ende des 19. Jahrhunderts in Europa zukommt. In diesem zeitlichen Umfeld und im Kontext der Metropole Paris vermittelt der Künstler andererseits auch ein gesellschaftliches Bild, das sowohl den Glanz als auch die Hybridität der Belle Époque zu erkennen gibt.
1901 im Alter von knapp 37 Jahren verstorben, repräsentiert Toulouse-Lautrec als Mensch und Künstler durch seine adelige Abstammung, seine gesundheitlichen und körperlichen Einschränkungen und seine Lebensführung selbst die Brüchigkeit einer Zeit, die seine Existenz und sein von akademischen Traditionen weitgehend gelöstes künstlerisches Werk bestimmte. In Toulouse-Lautrecs Œuvre treffen vom Pariser Nachtleben dynamisierte Bildkonzepte auf behutsame Beobachtung von Menschen und subtil erfasste Momentaufnahmen des gesellschaftlichen Lebens. Ebendieser Spannung gilt das kuratorische Interesse der Ausstellung. Sie verdeutlicht dabei vor allem den Aspekt der Authentizität eines Werks, das von Frankreich ausgehend international reüssierte und durch die konkrete Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte als ein besonders signifikanter Beitrag des europäischen Künstlers zur Weltkunst bezeichnet werden kann.
Ausstellungsthemen
Der räumliche Ablauf ist nach Themen gegliedert und widmet sich Aspekten wie dem frühen adeligen Landleben, Familie und Freunden sowie dem Leben in der Großstadt. Dort spielen dann Frauen und Vergnügungen eine zentrale Rolle, denen sich Toulouse-Lautrec beispielsweise in dem herausragenden Mappenwerk Elles widmete. Selbstverständlich werden auch zahlreiche seiner Plakate gezeigt, mit denen er die Farblithografie revolutionierte und die ihn so überaus populär machten.
Begleitende Ausstellungen
Parallel zur Schau Toulouse-Lautrec: Der intime Blick präsentiert die Landesgalerie drei weitere Ausstellungen, die das Thema des menschlichen Bildes zum Inhalt haben: Aus der Sammlung: Körperbilder – Egon Schiele, Gustav Klimt und Henri de Toulouse-Lautrec im Gotischen Zimmer kombiniert eine Auswahl von Arbeiten des französischen Künstlers mit Grafiken von Egon Schiele und Gustav Klimt. Vor genau 100 Jahren fand im Jahr 1909 in der Galerie Miethke in Wien die erste monografische Präsentation von Henri de Toulouse-Lautrecs Werken in Österreich statt und übte Einfluss auf Künstler wie etwa Schiele und Klimt aus. Im Kubin-Kabinett zeigt die Landesgalerie mit dem Titel Aus der Sammlung: Frauenbilder von Alfred Kubin zeitgleich mit den Werken Henri de Toulouse-Lautrecs eine Auswahl von Grafiken Alfred Kubins. Der Fokus auf die Thematik des „Frauenbilds“ ermöglicht einen einmaligen Vergleich zwischen zwei außergewöhnlichen formalen und inhaltlichen Herangehensweisen. In Ergänzung zu diesen historischen Arbeiten aus dem 19. und 20. Jahrhundert wird im Wappensaal eine junge künstlerische Position des 21. Jahrhunderts präsentiert, die das Medium Fotografie als Mittel der Vervielfältigung und Distribution von Kunst beleuchtet. In der Ausstellung L’image et l’objet setzt sich Claudia Angelmaier mit Bildern der Kunst und deren Geschichte auseinander. Bücher oder einzelne Buchseiten, Postkarten oder Dias, die „Meisterwerke der Kunst“ als Reproduktion zeigen, werden von ihr fotografisch inszeniert.
bis 7. Juni 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Sensai. Weiß – die Reinheit der Form in der japanischen Kunst
„Sensai“ bedeutet fein, minutiös und detailgetreu und ist eine Balance zwischen Abstraktem und Realität. Der Titel der Ausstellung Sensai soll jedoch nicht allein in seiner direkten Übersetzung präsentiert werden, sondern als „sensai no seishin“, als intuitive Erfassung der sich wandelnden Wirklichkeit, einer Balance zwischen Abstraktem und Realität, die den Werken japanischer Künstler eigen ist.
„Yohaku-no-bi“, das ist Schönheit des übrig gelassenen Weiß. Es steht für die Bedeutung leerer Räume und Flächen. Die sogenannten „Ukiyo-e“ von Meistern wie Hokusai, Hokkei und Hiroshige nahmen enormen Einfluss auf die europäische Holzschnitt- und Dekorationskunst des Jugendstils und die Kunst des beginnenden 20. Jahrhunderts.
Zu sehen sind mehr als 80 Werke von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart aus österreichischen Museen, internationalen Galerien und Privatsammlungen.
bis 26. April 2009
Badeszenen. Ritual, Entrüstung und Verführung
Badeszenen sind ein beliebtes Thema der Malerei, das der künstlerischen Fantasie größtmöglichen Raum bietet. Naturbeobachtungen, erotische Anspielungen, religiöse Rituale, eine Geschichte der Körperkultur und das Thema als Allegorie sind darin aufs Engste miteinander verwoben.
Der Beginn der europäischen Badekultur reicht bis in die Antike zurück. Wasser wurde stets als Quelle der physischen und metaphysischen Energie gefeiert. Badeanlagen versprachen körperliche sowie spirituelle Reinigung. Sie dienten der Hygiene, der Heilung von Krankheiten, befriedigten sowohl rituelle beziehungsweise religiöse Bedürfnisse als auch die reine Lust am Baden, die man gemeinsam mit dem anderen Geschlecht teilte. Werke aus dem Sammlungsbestand der Residenzgalerie Salzburg und zahlreiche Leihgaben aus dem In- und Ausland, darunter Gemälde und Grafiken namhafter Künstler, verdeutlichen die Vielfalt des Themas, ausgehend von der Antike bis in die zeitgenössische Kunst.
10. Juli bis 1. November 2009
Die ganze Pracht. Gemälde der Residenzgalerie Salzburg vom 16. bis 19. Jahrhundert
Das prächtige Ambiente entspricht dem hochkarätigen Bestand der Salzburger Landessammlung wie auch dem barocken Wesen der Stadt in idealer Weise.
Herausragend in ihrer qualitätvollen Dichte erweist sich die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts mit Werken von Peter Paul Rubens, Rembrandt, Jan van Goyen, Aelbert Cuyp, Salomon van Ruysdael, Jakob Isaacksz. van Ruisdael, Paulus Potter und vielen mehr.
Französische und österreichische Barockmalerei führt den Betrachter in eine Welt voll Dramatik, prallen Lebens und asketischer Geistigkeit: kraftvolles neapolitanisches „fa presto“ von Meistern wie Luca Girodano und Guercino neben delikaten Galanterien der französischen Meister François Boucher und Hubert Robert.
Abgerundet wird die Sammlung mit Werken von österreichischen Meistern des 19. Jahrhunderts wie Friedrich von Amerling, Josef Danhauser, Ferdinand Georg Waldmüller, Thomas Ender, Anton Romako und dem 1840 in der Salzburger Residenz geborenen Hans Makart.
13. November 2009 bis 7. Februar 2010
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.













































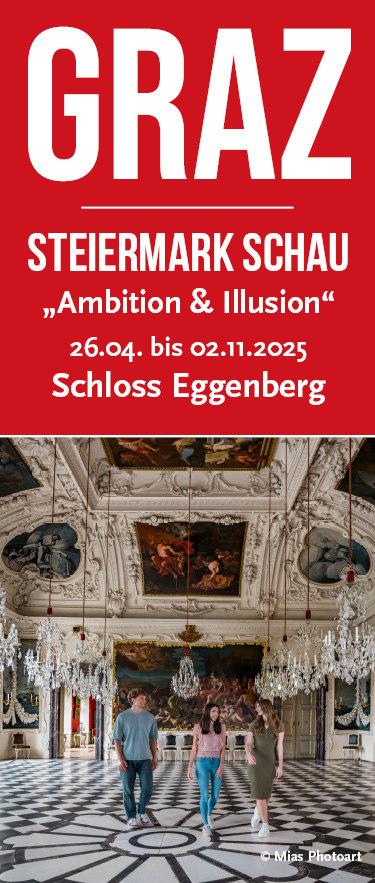







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.