Tickets und Infos Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut Musen an die Front!
Der unbekannte Verbündete - Bulgarien im Ersten Weltkrieg
Ausstellungskurator Mag. Peter Enne führt durch die Sonderausstellung.
Veranstaltungsvorschau: Der unbekannte Verbündete - Bulgarien im Ersten Weltkrieg - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!Österreich im Wandel der Zeit
Dr. Walter Kalina führt durch die Dauerausstellungen des Heeresgeschichtlichen Museums.
Veranstaltungsvorschau: Österreich im Wandel der Zeit - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!NATIONALFEIERTAG: COCKPIT-SITZEN UND PANZER-SCHAUEN
Eine weitere Attraktion ist der vor dem Museumseingang stattfindende Mittagssalut mit einem historischen Geschütz. Im Inneren des Gebäudes präsentiert der Österreichische Marineverband zahlreiche Schiffsmodelle. Wissenswertes über forst- und militärgeschichtliche Themen gibt es am Infostand der ARGE Forstkultur zu erfahren. Der Eintritt ins Museum ist für alle Besucherinnen und Besucher frei.
Veranstaltungsvorschau: NATIONALFEIERTAG: COCKPIT-SITZEN UND PANZER-SCHAUEN - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!ORF - LANGE NACHT DER MUSEEN / HGM
Besucher begegnen den ganzen Abend lang historisch Uniformierten, die Ausrüstung, Lagerleben und Exerzierweise von damals präsentieren. Zu den weiteren Programmhöhepunkten zählen ein Zinnfiguren-Diorama, die Präsentation einer Jubiläumsbriefmarke und ein buntes Kinderprogramm unter dem Motto „Auf den Spuren des Löwen von Aspern“.
Veranstaltungsvorschau: ORF - LANGE NACHT DER MUSEEN / HGM - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!Musen an die Front!
Schriftsteller, Maler, Schauspieler und Musiker reagierten oft auf sehr unterschiedliche Weise darauf. Diesem besonderen Aspekt widmet sich die Ausstellung des Adalbert-Stifter-Vereins, die in der Ruhmeshalle des HGM gezeigt wird.
Veranstaltungsvorschau: Musen an die Front! - Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut
Keine aktuellen Termine vorhanden!Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte
Anlässlich des 60. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschland und 20 Jahre Mauerfall zeigt die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis 11. Oktober 2009 die Ausstellung Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte. Sie analysiert die Entstehung, Verbreitung und Wirkkraft politischer Bilder aus der Zeit des Nationalsozialismus, der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Neben den Originalfotografien werden auch deren Verbreitung in Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten, Büchern und anderen Publikationen sowie deren künstlerische Adaption in Werken der bildenden Kunst, des Spielfilms und der Alltagskultur dokumentiert.
Bilder sind in der Mediengesellschaft allgegenwärtig und prägen unsere Wahrnehmung der Gegenwart und der Vergangenheit. Aus der Bilderflut ragen einige politische „Ikonen“ heraus: Historische Bildikonen sind Schlüsselbilder, die im kollektiven Gedächtnis als Abbild eines besonderen Ereignisses gespeichert sind. Sie dienen als konkrete Bezugspunkte unserer Erinnerung und sind nicht austauschbar – auch wenn viele Bilddokumente von einem historischen Ereignis existieren, so ist doch nur eines zur Ikone aufgestiegen.
Grundvoraussetzungen dafür sind eine eingängige Bildsprache, die Komplexität des Bildinhalts und ein möglichst großes Überraschungsmoment. Im Fall von Conrad Schumann gelang es dem Fotografen Peter Leibing, genau den Augenblick des Sprungs einzufangen – ein dramatischer Übergang zwischen Diktatur und Demokratie.
Entscheidendes Kriterium bei der Auswahl der Fallbeispiele für die Bonner Ausstellung waren die Bedeutung und der Bekanntheitsgrad der Bilder sowie deren Verankerung im kollektiven Gedächtnis. Die Ausstellung fragt nach der besonderen Kraft der Bilder: Woran misst sich die Qualität eines Bildes? Weshalb werden bestimmte Bilder stärker erinnert als andere? Wie ist ihre politisch-historische Bedeutung zu bewerten? Die Auswahl – die keinen Kanon konstruiert, geschweige denn postuliert – berücksichtigt exemplarische Bilder aus den verschiedenen Epochen deutscher Geschichte.
Die Stiftung hat mit verschiedenen Ausstellungsprojekten zum kritischen Umgang mit modernen Bilddokumenten beigetragen. Bilder, die lügen hat die Manipulation von und mit Bildern zum Gegenstand gehabt. Bilder und Macht im 20. Jahrhundert thematisierte die Bedeutung von Politikerbildern als Mittel politischer Kommunikation. Mit Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte wird diese Reihe abgeschlossen, die nach der Wirkkraft einzelner Fotografien aus dem Bilderfundus der deutschen Zeitgeschichte fragt.
Mark Dion: Über die Jagd/Concerning Hunting
Mark Dion gehört zu den Klassifikatoren unter den Künstlern. Ihn interessieren sozialhistorische Analysen, er arbeitet mit Naturwissenschaftlern und Kunstinstitutionen zusammen, um selbst wie ein Alchemist die Naturgeschichte als Typologie menschlichen Kulturwillens neu zu beschreiben und – wo nötig – mit Ironie neu zu erschaffen. Im Herbert-Gerisch-Skulpturenpark in Neumünster hat Mark Dion sechs Hochstände mit unterschiedlicher Ausstattung aufgestellt, die auf sechs Jägertypen schließen lassen. Neben der Hundehütte Kennel und The Ruin, dem zerstörten Hochsitz, gibt es ein Jagdversteck, das dem „Dandy-Rococo“ zugeordnet werden kann, eines, das unverkennbar auf The Slob (den „Schlampigen“) verweist, The Glutton charakterisiert den „Schlemmer“ und The Librarian den jagdfreudigen Bibliothekar. Neben den Installationen im Park gibt es eine Ausstellung in der Gerisch-Galerie und der Villa Wachholtz sowie eine Intervention im Jagdzimmer des Stifters Herbert Gerisch.
Die Ästhetik des Nebeneinanders von Kunst- und anderen Sammelobjekten, die der in New York und Pennsylvania lebende Künstler für diese kritische Weltsicht entwickelt, ist ausgefeilt und subtil wie in einer Kunst- und Wunderkammer der Renaissance. Das künstlerische Konzept von Mark Dion zielt auf Serialität ab und bemüht die altehrwürdige Wissenschaftstradition der Enzyklopädie. Mark Dion ist aber auch Psychologe, der den Besucher dazu bringt, über sich selbst als Typ nachzudenken. Schließlich ist jeder Mensch ein Jäger. Wie ein roter Faden zieht sich die künstlerische Untersuchung des Themas „Natur“ durch das Werk dieses außergewöhnlichen Künstlers. Seine Arbeiten erforschen die Ordnungsprinzipien des Kreatürlichen und lassen auch den Betrachter zum Sammler, Forscher und Abenteurer werden.
Charakteristisch für die künstlerische Arbeitsweise von Mark Dion sind die Überschneidungen von Fiktion und Realität, Kunst und Dokumentation. Mit der Ausstellung Concerning Hunting in der Gerisch-Stiftung in Neumünster setzt Dion seine Reihe der künstlerischen Eingriffe an vorgefundenen Situationen fort, welche die Grenzbereiche von Natur und Kultur, Wissenschaft und musealer Dokumentation analysieren. Wichtige Referenzkonzepte hat der amerikanische Künstler beispielsweise für das Naturhistorische Museum Maastricht, das Musée de la Chasse et de la Nature in Paris und das Château de Chambord (Loireregion) entwickelt. Der Gerisch-Skulpturenpark wurde im September 2007 in Neumünster eröffnet und wird in den nächsten Jahren als Naturpark entlang der Schwale erweitert. Die Ausstellung des international bekannten Künstlers ist ein besonderer Beitrag zu dem Rahmenthema des Skulpturenparks, das der künstlerische Leiter, Dr. Martin Henatsch, mit der Frage „Wo liegt Arkadien heute?“ formuliert hat und mit dem die kulturell geprägten Sichtweisen auf Natur im Spiegel der Kunst untersucht werden sollen.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Kunst im 20. Jahrhundert
Ein Jahr ist seit der Eröffnung des neuen Franz-Marc-Museums im Juni 2008 vergangen. Auf über 700 Quadratmetern präsentiert sich die hinzugewonnene Sammlung Etta und Otto Stangl mit Werken des „Blauen Reiters“, der „Brücke“-Künstler und der Künstlergruppe „Zen 49“, die sich auf die geistigen Prinzipien des „Blauen Reiters“ beruft. Franz Marc und sein Werk stehen weiterhin im Zentrum des musealen Konzepts. Der moderne Erweiterungsbau der Architekten Diethelm & Spillmann, Zürich, erhielt inzwischen mehr als eine Auszeichnung: Das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt (DAM) kürt das neue Franz-Marc-Museum zu einem der 26 besten Bauten in und aus Deutschland 2009/10. Das Haus mit herrlichem Blick auf den Kochelsee vereint hochkarätigen Kulturgenuss inmitten herrlicher Natur mit qualitativ hochwertiger Gastronomie und lädt so zum Verweilen ein. Ein umfangreiches Angebot an Kursen, Workshops und ein wachsendes Rahmenprogramm bieten den Bewohnern und Gästen der Region ein zusätzliches interessantes Freizeitprogramm.
Auf den Tag genau ein Jahr nach Eröffnung des neuen Franz-Marc-Museums wird die bisher umfassendste Sonderausstellung präsentiert:
Der Große Widerspruch. Franz Marc zwischen Delaunay und Rousseau
Im Kreis des „Blauen Reiters“, der deutschen Avantgardebewegung um Franz Marc und Wassily Kandinsky, ist das Interesse für Frankreich groß: Man reist nach Paris, trifft dort französische Malerkollegen und setzt sich mit aktuellen Tendenzen auseinander. Franz Marc lernte Robert Delaunay 1912 in Paris kennen und war fasziniert von den „Fensterbildern“, die er in seinem Atelier bewundern konnte. Delaunay inspirierte auch die Freunde Marcs vom „Blauen Reiter“, was auch im gleichnamigen Almanach von 1912 zum Ausdruck kam.
Bei der Suche nach Grundlagen für eine „neue“ Kunst erweckte der große Naive Henri Rousseau ebenso tiefe Bewunderung und Faszination. Stand Robert Delaunay im Almanach Der Blaue Reiter für die große Abstraktion, so repräsentierte Rousseau die große Realistik.
Der Spannungsbogen zwischen diesen beiden Polen ist Thema der Ausstellung, die sich damit auch einer wichtigen Episode des deutsch-französischen Dialogs im 20. Jahrhundert widmet.
Die Ausstellung will diese zwei unterschiedlichen – scheinbar widersprüchlichen – Perspektiven ins Auge fassen, die den „Blauen Reiter“ geprägt haben: die Faszination für die „große Abstraktion“, vertreten durch den französischen Kubisten Robert Delaunay, und die Begeisterung für die „große Realistik“, die im Werk des genialen Naiven Henri Rousseau verehrt wird.
Schlaglichtartig wird die Ausstellung Aspekte einer Kunst beleuchten, die bei aller Modernität auf eine hinter der Zivilisation und der gesellschaftlichen Konvention liegende Ursprünglichkeit zurückgreifen will. In diesem Bestreben werden den Künstlern des „Blauen Reiters“ außereuropäische Kunstwerke zum Vorbild, ebenso wie bayerische Volkskunst, Kinderzeichnungen, die französische Avantgarde oder mittelalterliche Madonnen.
Diese Vielfalt schlägt sich im Almanach Der Blaue Reiter nieder, der 1912 von Franz Marc und Wassily Kandinsky herausgegeben wird. Sie zeigt sich auch im Künstlerkreis des „Blauen Reiters“, den kein stilistischer Gleichklang verbindet. Jeder Künstler geht seinen eigenen Weg in der Überzeugung, dass der „innere Klang“ des Werks seine äußere Form bestimmt.
Dies führt die Ausstellung an exemplarischen Werkgruppen von Marc, August Macke, Kandinsky, Paul Klee, Gabriele Münter, Alexej von Jawlensky, Arnold Schönberg, Delaunay und Rousseau vor Augen, wobei bedeutende Leihgaben aus deutschen und internationalen Sammlungen den eigenen Bestand erweitern.
Ergänzend zur Ausstellung findet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen, Filmen und Workshops statt.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Hommage an eine Gründergeneration
Das Forum Konkrete Kunst beteiligt sich am 90. Jubiläum der Gründung des Bauhauses mit einem Projekt unter dem Thema „Hommage an eine Gründergeneration“, das sowohl ein Theoriekolloquium, die Ausstellung in der Peterskirche als auch die Aktion Die Kunst geht in die Stadt umfasst.
Gemeint ist keine Hommage an historische Künstlerpersönlichkeiten, sondern an die Geisteshaltung der Vordenker: vitales Interesse an Ergebnissen und Erscheinungen unserer Zeit und Gesellschaft, Neugier, Mut zu Neuem, denn all das haben die Künstler der Gründergeneration in Russland, Polen, den Niederlanden, Frankreich und eben auch am Bauhaus vorgelebt.
Das Forum Konkrete Kunst will zeigen, wie sich diese Ideen im Lauf der Jahrzehnte weiterentwickelt haben, wie die Saat der Gründergeneration aufgegangen ist. Damit befasste sich sowohl das Theoriekolloquium mit Referenten aus Polen, den Niederlanden, Frankreich, Österreich und Deutschland, und dies ist auch Anliegen der Ausstellung in der Peterskirche mit Beiträgen von 15 Künstlern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, Polen und Schweden.
Die Ausstellung zeigt Beispiele zeitgenössischer Konzepte der konkreten Kunst, bei denen neue Medien, industrielle Materialien und Methoden, Gedanken aus Wissenschaft und Philosophie sowie neu hinzugekommene Bereiche der visuellen Poesie und der konkreten Fotografie zugrunde liegen. So – um einige Beispiele herauszugreifen – 20 großformatige Polaroids von Inge Dick, die innerhalb einer genau definierten Zeit den Farbwandel einer weißen Fläche von Weiß zu Blauschwarz dokumentieren; das Einbeziehen des atmosphärischen Drucks als eines wesentlichen Gestaltungselements bei Ewerdt Hilgemanns Implosionen von drei Edelstahlkuben; die Faszination des Schweden Lars Englund von genormten, industriell gefertigten Kleinteilen, aus deren Kombination er ein tänzerisch im Raum schwebendes Tragwerk knüpft; oder die künstlerische Umsetzung der Thematik „Regel und Zufall“ von Jean-François Dubreuil aus Paris, der bei seinen Arbeiten von Tageszeitungen ausgeht und thematisch zusammengehörige Artikel mit vorher festgelegten Farben belegt. Josef Linschinger nutzt das Medium des Films, um sein Konzept „von der Linie zur Fläche“ oder umgekehrt sinnlich nachdrücklich erlebbar zu machen.
bis 23. August 2009
Die Kunst geht in die Stadt
Teil des Gesamtprojekts ist aber auch die Aktion Die Kunst geht in die Stadt, mit der eine Idee der Künstler vom Beginn des 20. Jahrhunderts aufgenommen wird, Kunst und Alltag zusammenzuführen.
Diesem Traum folgend, lädt das Forum Konkrete Kunst nicht nur Besucher zu einer Ausstellung in die Peterskirche ein, sondern bringt in Umkehrung dessen die Kunst zu den Menschen in der Stadt, wo sie den Werken auf ihren alltäglichen Wegen begegnen.
Als zusammengehöriges Projekt erkennbar sind die Unikatgrafiken durch eine im Vorhinein auf den unteren Rand des Bogens gedruckte Themenzeile: „Hommage an eine Gründergeneration – die Kunst geht in die Stadt“. Allein die Anzahl der bei dieser Aktion Beteiligten – 93 Künstler aus neun europäischen Ländern und 30 Einrichtungen in der Stadt – zeigt, welchen Anklang die Idee gefunden hat. Begleitend dazu gibt es ein Informationsblatt.
Vom 13. September bis 11. Oktober 2009 werden alle eingesendeten Grafiken in der Peterskirche gemeinsam mit einer Dokumentation in einem Katalog präsentiert.
Informationen
Forum Konkrete Kunst
Peterskirche auf dem Petersberg Erfurt
Mi–So 10–18 Uhr
www.forum-konkrete-kunst-erfurt.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Antike lebendig erleben
Den Besuchern offenbart sich der Europäische Kulturpark in vielen Facetten: Die grenzüberschreitende Lage – direkt an der deutsch-französischen Grenze zwischen dem französischen Bliesbruck und dem deutschen Reinheim – trägt dem europäischen Gedanken Rechnung, indem sie die „grenzenlose“ und damit gemeinsame Vergangenheit der beiden Nachbarvölker demonstriert. Die bedeutenden Funde und Befunde der keltischen und römischen Kultur an einem Ort machen ihn einzigartig und ermöglichen es den Besuchern, eigene Interessenschwerpunkte zu setzen. Schließlich lässt die Verbindung von Kultur und Natur – historisches Erbe eingebettet in eine schöne Kulturlandschaft mit ökologisch wertvollen Flussauen inmitten des UNESCO-Biosphärenreservats Bliesgau – den Besuch des Parks zu einem einmaligen Erlebnis werden.
Auf über 70 Hektar Fläche erforschen deutsche und französische Archäologen seit mehr als 20 Jahren die gemeinsame Geschichte und können bisher eine Besiedlung bis zirka 6000 vor Christus nachweisen. Die archäologische Sensation ist nach wie vor das 1954 entdeckte Grab der „Keltenfürstin von Reinheim“ aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Eine beeindruckende Nachbildung der keltischen Nekropole mit dem begehbaren „Grabhügel der Keltenfürstin“ bildet heute neben der unmittelbar benachbarten römischen Villa und dem römischen Vicus mit Thermenanlage und einem Handwerkerviertel eines der Highlights des Parks.
Der Veranstaltungskalender des Kulturparks ist prall gefüllt mit Veranstaltungen, welche die Gäste in die spannende Welt der Kelten und Römer eintauchen lassen.
Beim gallorömischen Kinderfest entdecken die Kinder des 21. Jahrhunderts mit Spiel und Spaß die Aktivitäten der Vergangenheit sowie die Arbeit der Archäologen.
Das traditionelle Johannisfest mit Open-Air-Konzert und riesigem Johannisfeuer ist seit einigen Jahren ein Magnet für zahlreiche Besucher aus nah und fern.
Für zwei Tage im August ist der Parc Archéologique Européen fest in der Hand römischer Lebensart. Wagemutige Gladiatoren und Legionäre, tüchtige Händler und fingerfertige Handwerker erwarten die Besucher anlässlich der Vita Romana.
Beim Keltenfest – einem bunten und lehrreichen Spektakel aus der Antike – veranschaulichen verschiedene Reenactment-Gruppen das Leben keltischer Krieger und Handwerker und faszinieren mit ihrer Kampftechnik und ihrem Geschick beim Herstellen von Waffen, Messern, Bronzeschmuck sowie beim Spinnen und Weben. Mit Samhain, dem keltischen Neujahrsfest, bei dem die Tore zur „Anderswelt“ geöffnet sind, lässt der Park im Keltendorf die Saison ausklingen.
Neben zahlreichen historischen Festen werden in dieser antiken Kulisse Freizeit- und Ferienprogramme, musikalische Sonntagsmatineen und Workshops angeboten, die der ganzen Familie in landschaftlich wunderschönem Ambiente den Alltag der Kelten und Römer spielerisch näherbringen.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.









 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner 














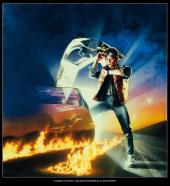
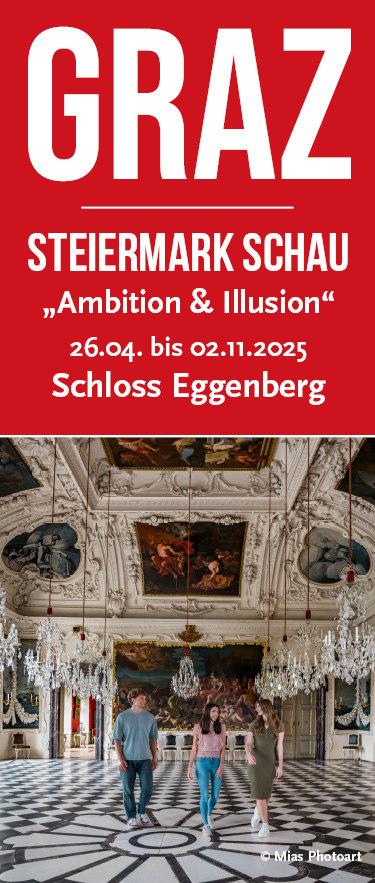







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.