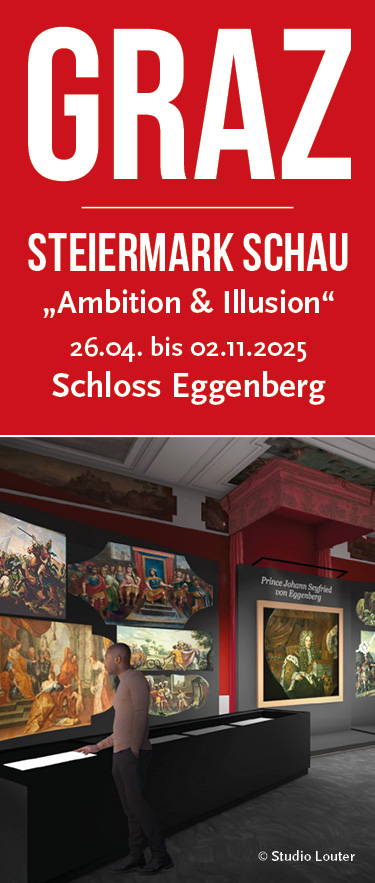Tickets und Infos Naturhistorisches Museum Science Goes Public - Darwins rEvolution
Otto Dix – Die Goldenen Zwanziger Jahre
Während des Ersten Weltkrieges setzte er sich als Freiwilliger bewusst der Realität des Krieges aus. In Frankreich, Flandern und Weißrussland entstanden Hunderte von Zeichnungen und Gouachen. "Der Krieg war eine scheußliche Sache, aber trotzdem etwas Gewaltiges", resümierte Dix später. "Das durfte ich auf keinen Fall versäumen! Man muss den Menschen in diesem entfesselten Zustand gesehen haben, um etwas über den Menschen zu wissen!"
Die sogenannten Goldenen Zwanziger Jahre, die in Wirklichkeit den Bankrott der westlichen Zivilisation bedeuteten, erlebte Dix ambivalent und aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Im Zentrum seiner Betrachtung steht jedoch immer der Mensch, wobei sich allgemein menschliche Aspekte mit gesellschaftlichen und zeitrelevanten verschränken. Eine Reihe hochkarätiger Aquarelle und Druckgraphiken, die bis zum 10. Januar 2010 in einer Kabinettausstellung im Buchheim Museum zu sehen ist, vermögen dies zu vergegenwärtigen.
Virtuos gemalte Blätter wie "Der Selbstmörder" (1922) und "Modernes Tanzpaar" (1922) charakterisieren eine Zeit, die von Depression, Hoffnungs- und Orientierungslosigkeit, aber auch von Hedonismus, übersteigerter Lebenslust und Lebensgier gekennzeichnet war. Der verlorene Krieg, der Abertausenden das Leben gekostet und viele psychisch wie körperlich zugrunde gerichtet hatte, die empfundene Ohnmacht des Einzelnen angesichts der Kriegsmaschinerie und der katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse – all das provozierte den sprichwörtlichen Tanz auf dem Vulkan. Wer konnte, und dazu gehörte auch Dix, gab sich den Vergnügungen städtischer Amüsierbetriebe rauschhaft hin.
Dix war nicht nur ein leidenschaftlicher und fabelhafter Tänzer – seine Vorliebe für den Shimmy, einen amerikanischen Modetanz, brachte ihm den Spitznamen Jimmy ein. Dazu legte er großen Wert auf perfektes Styling, liebte die Verwandlung und Rollenspiele. Bald gab der in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Arbeitersohn den antiintellektuellen Proleten, bald den stilsicheren Gentleman, bald den Dandy... Sein Auftritt mit fliegendem Cape, großem Hut und Handkuss überraschte auch die Galeristin Johanna Ey, eine rückhaltlose Förderin junger Talente, die Dix im Oktober 1921 nach Düsseldorf eingeladen hatte. "Erinnerung an die herrlichen Tage in Düsseldorf" schrieb Dix auf ein mit Bleistift gezeichnetes Selbstbildnis, das er "Frau Ey" 1921, wohl nach seiner Rückkehr nach Dresden, widmete. Jetzt ist das Blatt im Buchheim Museum zu sehen.
Der Düsseldorfer Aufenthalt war für Dix in mehrfacher Hinsicht folgenreich. Denn er konnte nicht nur Kontakte zu Galeristen, Sammlern und anderen Künstlern im Rheinland aufbauen. Dix verliebte sich in Martha (Mutzli), die Frau von Dr. Hans Koch, seinem wichtigsten Mäzen. 1923 heiraten beide. Erst im Herbst 1922 zog Dix für drei Jahre nach Düsseldorf, wo er sich vorwiegend der Aquarellmalerei widmete, was vor allem mit der wirtschaftlichen Situation in den Inflationsjahren 1922 und 1923 zusammenhing. Karl Nierendorf ("Nierendix"), Dix’ Kölner Galerist, hatte klar erkannt, dass Wasserfarbenblätter nun besser verkäuflich waren als großformatige, kostspielige Gemälde und regte Dix zum Aquarellieren an.
Blätter wie "Mieze, abends im Café" (1923) und "Modernes Tanzpaar" spiegeln Dix’ Hang zur mondänen Welt wider. Doch Ironie und karikaturhafte Überspitzung verweisen auf deren Fragilität und Brüchigkeit: Die Schönen der Nacht wie die kapriziös anmutende "Mieze" mit dem modischen Kopfputz, oder das, ganz den Rhythmen der Musik hingegebene und in grotesker Bewegung vereinte Paar, sind schillernde Gestalten und Protagonisten einer künstlichen Welt. Ihren Glanz vermögen sie allenfalls im schummrigen Licht der Bars und Nachtetablissements zu entfalten. Wie der von seiner eigenen Schönheit befeuerte, über dem Boden schwebende "Gott der Friseure" (1922) fühlen sie sich für Augenblicke der Wirklichkeit enthoben. Eine andere Form von Realitätsflucht verkörpert das in mehrfacher Hinsicht enthemmte "Betrunkene Liebespaar" (1923): ein grobschlächtiger Matrose, der mit seiner vollbusigen Geliebten bei Sonnenaufgang über ein Hafengelände torkelt. Für den Selbstmörder hingegen gab es kein Entfliehen, kein Vergessen, keinen Ausweg mehr. In größter Einsamkeit und Verzweiflung hat er sich in einer Kammer erhängt, deren kleinbürgerliche Ordnung die Grausamkeit des Geschehens und die Gleichgültigkeit der Umwelt unterstreicht. Eros und Tod werden in Blättern wie "Das Erwachen" (1922) und "Mutter und Kind" (1922) thematisiert: Die greisenhaften Gesichtszüge des Säuglings gemahnen weniger an die Geburt, denn an das Ende allen Lebens. Um das Thema Vergänglichkeit und Tod kreisen weitere Arbeiten aus den frühen 1920er Jahren.
Veranstaltungsvorschau: Otto Dix – Die Goldenen Zwanziger Jahre - Buchheim Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Exposition de Noël
Zu sehen sind Werke von Lena Brauer, Benedetto Fellin, Susanne Steinbacher, Jolanda Richter und Marcus Stiehl.
Veranstaltungsvorschau: Exposition de Noël -
Keine aktuellen Termine vorhanden!Mahony. Kimm Sun Sinn
Hierbei spielen geschichtliche Herleitungen, konstruierte Geschichten und entstandene Mythen sowie die aus ihnen resultierenden emotionalen Besetzungen des Reisemotivs eine grundlegende Rolle. Für eine künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen ist die Aufgabe des fixen Arbeitsplatzes und eine damit einhergehende ständige Neuverortung der Position von entscheidender Bedeutung. Das Phänomen des Entwurfs einer Reise sowie die Vorstellung von der „Entdeckung“ (fremder) Orte stehen im Mittelpunkt der künstlerischen Untersuchung.
Das Projekt der vierköpfigen, 2002 in Wien gegründet Künstlergruppe Mahony, bestehend aus Andreas Duscha, Stephan Kobatsch, Clemens Leuschner und Jenny Wolka, ist angelegt auf verschiedene Phasen: Die Vorbereitung für dieses Projekt bedeutete Recherche und gipfelte in einer Präsentation in ihrer Wiener Galerie, die sie zusammen mit von ihnen eingeladenen Künstlergästen realisierten. Im Oktober 2008 begann schließlich die reale Reise mit Stationen in London, Lima, Buenos Aires oder etwa am Kap Hoorn, auf der kontinuierlich Arbeiten entstanden, die zum Teil in Kooperation mit ansässigen Kulturinstitutionen und Künstler/innen in Ausstellungen vor Ort präsentiert wurden. Den Abschluss des Projektes bildet die Schau in der Factory der Kunsthalle Krems, die sowohl eine Reisedokumentation wie auch einen Überblick über die während der Reise entstandenen Werke ermöglichen wird.
Veranstaltungsvorschau: Mahony. Kimm Sun Sinn - Factory
Keine aktuellen Termine vorhanden!Wenn die Erde bebt
Die Wanderausstellung ist ein Beitrag Österreichs zum Internationalen Jahr des Planeten Erde im Rahmen von „Planetearth – Earth Sciences for Society“, 2007–2009.
Sieben, teils multimediale Stationen führen durch die Themen: Zerstörung
und Bedrohung, Ursachen und Auswirkung, über Erforschen und
Beobachten bis hin zu Leben mit Beben und erdbebensicheres Bauen.
Die Ausstellung wird von verschiedenen Vermittlungsprogrammen für
unterschiedliche Altersgruppen begleitet.
Veranstaltungsvorschau: Wenn die Erde bebt - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!KONTROVERSEN. JUSTIZ, ETHIK UND FOTOGRAFIE
Die präsentierten Bilder begleiten die Geschichte der Fotografie von ihren Anfangstagen bis heute. Seit ihrer Erfindung im Jahre 1839 hat die Fotografie zahlreiche gerichtliche, ethische und politische Kontroversen ausgelöst. Die Geschichte dieser Konflikte zeigt, wie ganze Gesellschaften und der Einzelne jeweils mit den Bildern ihrer Zeit umgingen. In jedem Bereich und Genre – Kunst, Politik, Wissenschaft, Journalismus, Mode und Werbung – war die Fotografie dem Urteil von Gerichten, der öffentlichen Meinung und den Auffassungen von Privatpersonen unterworfen. Fotografie befindet sich im Spannungsfeld kollidierender Rechte, wie etwa dem auf künstlerische Freiheit und dem Recht des Einzelnen auf Kontrolle über sein eigenes Bild. Entsprechend waren Fotografien häufig Zensur, Zerstörung oder Manipulation ausgesetzt. Viele der führenden Fotografen des 19. und 20. Jahrhunderts standen wegen ihrer Arbeiten vor Gericht.
Die Ausstellung, die sehr bekannte Werke ebenso wie weniger bekannte Fotografien umfasst, wurde vom Musée de l'Elysée Lausanne entwickelt und von Daniel Girardin, Senior Curator am Musée de l’Elysée und Christian Pirker, Rechtsanwalt in Genf, kuratiert. Die Ausstellung wird in Wien von Andreas Hirsch als Kurator des KUNST HAUS WIEN betreut.
Veranstaltungsvorschau: KONTROVERSEN. JUSTIZ, ETHIK UND FOTOGRAFIE - KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser
Keine aktuellen Termine vorhanden!Science Goes Public - Von der Expedition zur Publikation – neue Käferarten für die Wissenschaft
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft!
Veranstaltungsvorschau: Science Goes Public - Von der Expedition zur Publikation – neue Käferarten für die Wissenschaft - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Science Goes Public - Alles Käfer – Interessantes aus dem Leben der fliegenden Ritter
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft!
Veranstaltungsvorschau: Science Goes Public - Alles Käfer – Interessantes aus dem Leben der fliegenden Ritter - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Science Goes Public - Leben unter Tage - Höhlentiere
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft!
Veranstaltungsvorschau: Science Goes Public - Leben unter Tage - Höhlentiere - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Science Goes Public - Darwins rEvolution
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft!
Veranstaltungsvorschau: Science Goes Public - Darwins rEvolution - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Science Goes Public - Darwins rEvolution
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft!










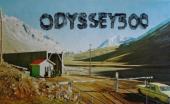

 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner