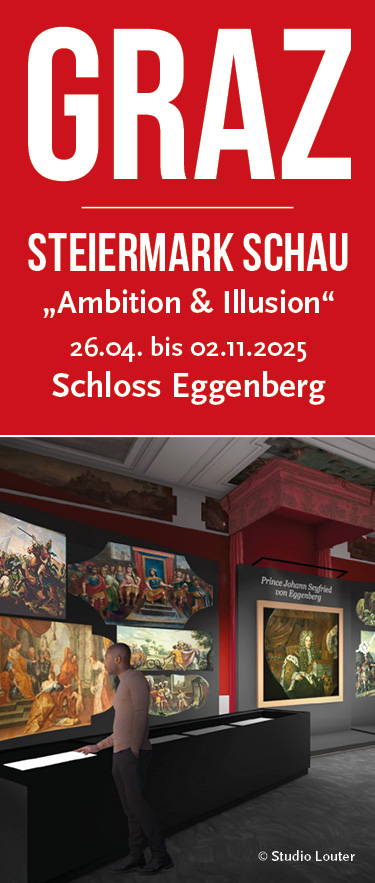Tickets und Infos Salzburger Landestheater Maestro
wirkinderdesnetzes
Wer ist @linka? Eine der braungebrannten Vertreterinnen der xxy Generation, die verrückt sind nach heruntergeladenen Handy-Hintergrundbildern? Ein dünner Junge mit asymmetrischem Pony und bloßen Füßen in weißen Tennisschuhen, der Independent-Musik hört? Ein Kinderschänder? Eine Post-Lacan Feministin, noch außer Atem von einem H&M Überfall? Ein 17-jähriges Mädchen aus der polnischen Provinz? Ein Mann aus Mexiko? „You don´t know me, but I know you“ – das sind die Worte, mit denen die vermutlich weibliche Bloggerin @linka die Besucher ihrer Website begrüßt. Schonungslos und mit bitterbösem Humor spielt sie mit Identitätsmustern, durchbricht die Schwellen zwischen Fiktion und Realität und analysiert messerscharf die gesellschaftlichen Auswüchse unserer webgenerierten Zeit.
Veranstaltungsvorschau: wirkinderdesnetzes - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Penthesilea
Es ist Krieg. Die Amazonen und ihre Königin Penthesilea erscheinen auf dem Schlachtfeld, um zu kämpfen und so zur Erhaltung ihres Geschlechts junge Männer einzufangen. Auf der anderen Seite des Schlachtfelds erscheint Achill, der strahlende Held der Griechen, mit seinen Männern. So stehen sie voreinander: Penthesilea und Achill, zwei Krieger, die von Liebe nichts verstehen. Doch sie entflammen in Leidenschaft. Gegen jede Regel, ohne jede Grenze. Achill ist zunächst Sieger des Zweikampfes. Die Amazone ist geliebt, doch durch ihn unterworfen, gedemütigt. Wird sie gegen das Gesetz der Amazonen handeln und zu ihrer Liebe stehen oder wird sie das Recht der Amazonen verteidigen und Achill in einem weiteren Kampf zu bezwingen versuchen? Die Schlacht geht weiter. Ihre Liebe führt sie in die Raserei.
Veranstaltungsvorschau: Penthesilea - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Wie der Soldat das Grammofon repariert
Aleksandar ist im bosnischen Višegrad aufgewachsen und hat von seinem Opa das Erzählen von kleinen, großen, komischen und traurigen Geschichten gelernt, das Erzählen seiner Geschichte. Als Jugoslawien um ihn herum zerfällt und der Bürgerkrieg aufkeimt, fliehen seine Eltern mit dem 14-Jährigen nach Deutschland. Doch seine Kindheit lebt fort in den unzähligen Geschichten über Landschaften, Menschen und Dinge, die in seiner Erinnerung bleiben. Durch seine Phantasie des Erzählens holt er das Verlorene zurück: die Kindheit in der Großfamilie, die zurückgelassenen Freunde, die Kriegsereignisse, Drina, die schöne Asija. Die geografische Verschiebung vom heimatlichen Fluss Drina zur fremden Essener Autobahn hinterlässt ihre Spuren. Aleksandar lässt sich das Haar wachsen, träumt auf Deutsch, wird zum Fußballfan von Schalke 04, doch seine Heimat findet er allein im Geschichten erzählen, das ihm Halt in einer ansonsten haltlosen Welt gibt.
Veranstaltungsvorschau: Wie der Soldat das Grammofon repariert - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Das Wetter vor 15 Jahren
Nachdem Wolf Haas keinen Brenner-Krimi mehr schreiben wollte, hat er eigentlich seinen ersten Liebesroman auch nicht geschrieben – er redet nur über ihn. In einem fiktiven Interview. Mit einer fiktiven deutschen Journalistin, der fiktive Haas. Und in dessen Roman geht’s um einen Gewinner von »Wetten dass …?«, der alle Wetterberichte der letzten 15 Jahre in dem österreichischen Urlaubsort Farmach auswendig weiß. Weil er damals traumatisiert wurde, von seiner großen Liebe. Die versucht er jetzt wieder zu erobern, bevor es zu spät ist und sie einen anderen heiratet. Das gelingt auch, aber Tote gibt’s trotzdem. Kritiker schwärmten von der komplexen wie aberwitzigen Konstruktion dieses Rezeptions-Romans, der sich wie eine »langsam aufschaukelnde Screwball-Komödie« lese, um schließlich die »Handlungsexzesse explosionsartig in einem grand finale« einstürzen zu lassen.
Veranstaltungsvorschau: Das Wetter vor 15 Jahren - Schauspielhaus Graz - Schauspielhaus
Keine aktuellen Termine vorhanden!Die fetten Jahre sind vorbei
Peter und Jan sind ein Team. Gemeinsam steigen die beiden WG-Genossen nachts in die schönsten Villen ein - um deren Besitzer zu erziehen. Sie stehlen nichts, aber durchwühlen und verrücken den gesamten Privatbesitz der "Reichen" und hinterlassen immer dieselbe Botschaft: "Die fetten Jahre sind vorbei! Gezeichnet DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN." Peter und Jan wollen Widerstand leisten gegen das System, wollen verunsichern. Doch dann zieht Peters Freundin Jule, echtes Opfer des Systems, in die Männer-WG ein und die Ereignisse überschlagen sich. Jule erfährt vom nächtlichen Treiben der Jungs, steigt mit Jan in die Villa von Hardenberg ein - des Mannes, der ihr Leben ruiniert hat. Am Ende der Nacht sind Jule, Jan und Peter als Entführer mit dem überraschend zurückgekehrten Hardenberg unterwegs in ein abgelegenes Bergdorf. Die Entführung wird zum Problem. In der Abgeschiedenheit müssen sich die vier mit sich und den eigenen Problemen auseinandersetzen: Was bedeutet es heute, politisch und jung zu sein? Sind die 68er jetzt das System? Was ist stärker: Liebe oder Freundschaft? Hat noch jemand was zu kiffen und wer hat den besten Musikgeschmack? Nach dem Erfolgsfilm des Vorarlbergers Hans Weingartner.
Hans Weingartner wurde 1970 in Feldkirch geboren, studierte erst Physik und Neurowissenschaft in Wien und diplomierte in Neurochirurgie in Berlin. Er ließ sich als Kameraassistent ausbilden, studierte Film und Fernsehen an der Kunsthochschule für Medien in Köln und feierte bereits erste Erfolge mit seinem Abschlussfilm Das weiße Rauschen. Der Spielfilm Die fetten Jahre sind vorbei brachte ihm 2004 den internationalen Durchbruch.
Veranstaltungsvorschau: Die fetten Jahre sind vorbei - Vorarlberger Landestheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Gezeiten der Nacht
Eine irische Familiengeschichte: Drei Schwestern, ihr Vater und ihre Großmutter leben zusammen in einer kleinen Provinzstadt. Die Mutter ist vor fünfzehn Jahren weggegangen und noch immer ist die Lücke, die sie hinterlassen hat, groß und für alle schmerzlich. Lily, die Großmutter, sieht mit Vorliebe Filmklassiker im Fernsehen an, stellt dabei aber den Ton aus. Und sie träumt davon, noch einmal einen Liebhaber zu haben. Nach Liebe sehnen sich auch die anderen Familienmitglieder, nach Liebe und nach Anerkennung.
In diesen Haushalt kommt John, ein Schauspieler, der den irischen Schriftsteller William Butler Yeats in einem romantisierenden Film verkörpern soll. Auch John hat seine Mutter verloren und sowohl Lily als auch Rose, die mittlere Schwester, fühlen sich zu dem attraktiven Schauspieler hingezogen. Judith, die älteste und ernsthafteste Tochter, fährt nach London, um ihre Mutter zu besuchen und kehrt bitter enttäuscht zurück. Und Patrick, der Vater, zeigt in seinen Whiskeyräuschen oft überraschend zynischen Scharfsinn.
Die junge britische Schauspielerin und Autorin Rebecca Lenkiewicz hat mit Gezeiten der Nacht ein bezauberndes Stück über das Trauma einer Familie geschrieben, von der Mutter verlassen worden zu sein. Wie sich die unterschiedlichen Gefühlswelten ihrer Figuren, die sich der uneingeschränkten Sympathie des Zuschauers sicher sein können, in ihrer Sprache spiegeln und sich zu einem sensibel portraitierten und fein arrangierten Drama über Abschied, Liebe und Aufbruch verdichten, zeugt vom großen Talent der jungen Autorin, deren erst zweites Stück bereits am Londoner National Theatre uraufgeführt wurde. Das Vorarlberger Landestheater zeigt Gezeiten der Nacht als Österreichische Erstaufführung.
Veranstaltungsvorschau: Gezeiten der Nacht - Vorarlberger Landestheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Hamlet, Prinz von Dänemark
Sein oder Nichtsein – Hamlet. Die vielleicht berühmteste Theaterfigur aller Zeiten. Und eine Geschichte im Staate Dänemark, in der es um mehr geht, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.
Hamlet wird vom Geist seines Vaters beauftragt, dessen Ermordung zu rächen. Zu rächen an Hamlets Onkel Claudius, jetzigem König von Dänemark und Gatte von Hamlets Mutter. Der Student aus Wittenberg soll die Welt im heimatlichen Helsingör wieder einrenken und mag sie doch eigentlich kaum ertragen. Studienfreund Horatio will ihm Begleiter sein, Ophelia Geliebte – aber immer wieder zieht Hamlet sich in die Einsamkeit seiner Monologe zurück. Und während der Staat sich eigentlich im Krieg befindet, ist ihm die scheinbar größte Freude das Theater, dessen Schauspieler und die Welt des „als-ob“.
William Shakespeare (1564 - 1616) schuf mit Hamlet eines der meistdiskutierten Theaterstücke überhaupt. Zuletzt in der Saison 1982/1983 am Vorarlberger Landestheater.
Veranstaltungsvorschau: Hamlet, Prinz von Dänemark - Vorarlberger Landestheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Diesseits
Paula zieht Bilanz: "Berufliche Erfüllung, irgendeine sinnvolle Tätigkeit von gesellschaftlicher Bedeutung: keine blasse Spur davon in meinem Leben. Aber nicht nur das: Auch Liebe hat es nicht gegeben, Leidenschaft, einen Lebenspartner, nicht einmal einen Orgasmus habe ich gehabt." Und weil die persönliche Bilanz derart negativ ausfällt, sieht sie nur einen Ausweg: Eine Überdosis. Dumm nur, dass die Arztpraxis, die sie überfallen will, um an genügend Schlaftabletten zu kommen, sich als Bank herausstellt und der Schalterbeamte Dietmar ernsthaftes Interesse an Paula zeigt. Also wird das erst mal nichts mit dem Selbstmord und Paula muss sich mit der Tatsache auseinander setzen, dass bei ihr ein Verdacht auf Gehirntumor besteht. Ob er gutartig oder bösartig ist, wird sie erst in einigen Tagen erfahren. Aber wie leben bis dahin - mit der Ungewissheit im Kopf? Paulas Vater, eigentlich vor Jahren an einem Gehirntumor gestorben, ist plötzlich da. Er begleitet seine Tochter bei ihren nächsten Schritten, stellt sich einer Auseinandersetzung, die es zu seinen Lebzeiten nicht gegeben hat. Und Paula beginnt ihr Leben neu zu sortieren, immer den alles entscheidenden Termin beim Arzt fest im Blick. Thomas Jonigk, geboren 1966, ist Dramaturg und Hausautor am Düsseldorfer Schauspielhaus, an dem er auch das Autorenlabor leitet. Für sein Stück Rottweiler wurde er 1994 von Theaterheute zum Nachwuchsautor des Jahres gewählt. Er arbeitet auch als Regisseur, unter anderem an der Volksbühne Berlin und am Schauspielhaus Wien. Am Düsseldorfer Schauspielhaus erlebte Diesseits im Herbst 2007 seine Uraufführung. Das Vorarlberger Landestheater zeigt die Österreichische Erstaufführung des Stückes.
Veranstaltungsvorschau: Diesseits - Vorarlberger Landestheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Elementarteilchen
Bruno und Michel sind Halbbrüder und Söhne einer Mutter, die ihr Leben ganz der Entfaltung ihrer eigenen persönlichen Freiheit gewidmet hat. Beide werden getrennt von ihren Großmüttern aufgezogen. Bruno, der Lehrer wird, entwickelt eine lebenslange Sexbesessenheit, hat aber beim anderen Geschlecht kaum Glück. Er ist der Prototyp eines modernen Menschen, der, überfordert vom Kampf um Anerkennung in Beruf und Liebe, seine Erdenzeit zwischen Supermarkt, Arbeitsplatz und Swingerclub verbringt. Der depressiv wirkende Michel, der ein bekannter Forscher auf dem Gebiet der Molekularbiologie wird, zeigt dagegen zeitlebens eher wenig Interesse an Sex und Frauen. Er sucht nach der Formel, die das Leben ohne Leid und Altern ermöglicht. Am Ende steht die bahnbrechende Entdeckung für die Erzeugung einer neuen geschlechtslosen und unsterblichen Menschenrasse: Das Klonen.
Die beiden Helden begegnen in ihrer "lebenslänglichen Höllenfahrt“ jeweils einem möglichen Lebenspartner, der für beide die Möglichkeit zur Überwindung all ihrer Leiden verspricht. In dieser romantischen Setzung erleben sie die Hoffnung auf das große Glück, aber auch das Leid einer Liebe, die sich nicht erfüllen darf in einer Welt, in der selbstdas Private Marktgesetzen unterworfen ist. Die Ausweitung der Kampfzone ins Private als Folge eines nicht mehr zu bremsenden Turbokapitalismus.
Veranstaltungsvorschau: Elementarteilchen - Landestheater Linz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Maestro
„Es gibt keinen anschaulicheren Ausdruck der Macht als die Tätigkeit des Dirigenten“, schreibt Elias Canetti. Das gilt für alle bedeutenden Dirigenten, so natürlich auch für Herbert von Karajan: „Denken Sie an meine Worte: Dieser Mann wird dem Musikleben im nächsten Vierteljahrhundert seinen Stempel aufdrücken“, so Karajans berühmter Kollege Victor de Sabata 1939 über den jungen Dirigenten. Doch war es das nächste halbe Jahrhundert, das Herbert von Karajans Stempel tragen sollte. Das Stück „Maestro“ ist ein Stationendrama: der gealterte Herbert von Karajan zieht sich in sein Haus in Anif zurück und sieht sich im Keller im Ton- und Musikstudio seine Home-Videos an. Die Erinnerung setzt ein. Die Kindheit, der Krieg, die Karriere, Salzburg, Berlin, Frauen, Freunde, Konkurrenten, Kritiker und Träume tauchen auf und wieder ab in das Dunkel der Einsamkeit eines alten Mannes. Der große Dirigent lebt schließlich in seinem Gefängnis der Wünsche. Karajans Wunsch war es zeitlebens, die perfekte Kunst in den Philharmonien der Welt, bei den Salzburger Festspielen, sowie in Einspielungen auf Schallplatte, CD und den Videos eigener Auftritte und Inszenierungen darzubieten. Aber schließen sich Perfektion und Kunst nicht aus? Karajan galt als machtvoller Perfektionist der Musik und ihrer Vermarktung, als unnahbarer Herrscher des selbst erschaffenen Mythos. In „Maestro“ erleben wir seine Triumphe, aber auch Irrtümer zwischen Politik und Kunst noch einmal neu. Am Ende seines Lebens verliert er die Macht über sein Orchester, die Berliner Philharmoniker. Elias Canetti schreibt über den Dirigenten, dass für ihn „während der Aufführung die Welt aus nichts anderem bestehen soll als aus dem Werk“ und der Maestro genauso lange der Herrscher dieser Welt ist.