Ausstellung
Einzigartiges Zusammenspiel von Kunst, Geschichte, Literatur, Musik und Technik
Carl-Maria-von-Weber-Museum
Dresdner Straße 44, das einzige Museum, das Carl Maria von Webers Leben und Werk gewidmet ist. Hier entstanden unter anderem die Opern Der Freischütz, Euryanthe und Oberon sowie die Aufforderung zum Tanz. Jedes Jahr locken das Elbhangfest (27. und 28. Juni), die Museumssommernacht (11. Juli) sowie ein Weinfest (27. September) viele Besucher hinaus zu Webers idyllischem Sommersitz.
Das Kraszewski-Museum
Nordstraße 28, ist dem polnischen Literaten Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887) gewidmet. Das Museum gibt einen umfangreichen Einblick in das Leben dieses vielseitigen Schriftstellers. Ferner erinnert es an die vielfältigen kulturellen und politischen Beziehungen zwischen Sachsen und Polen. Am 17. Mai findet hier ein „Fest der Sprache“ statt, und vom 16. bis 20. September gibt es erstmals die „Polnischen Kulturtage“.
Das Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik
Hauptstraße 13, gehört zu einem Ensemble beachtlicher Bürgerhäuser, die aus der Zeit Augusts des Starken erhalten geblieben sind. Der Porträt- und Historienmaler Gerhard von Kügelgen (1772–1820) bewohnte mit seiner Familie das zweite Obergeschoss des Hauses. In neun thematisch gestalteten Räumen wird ein bedeutsamer Teil der Dresdner Kultur- und Geistesgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts wieder lebendig.
Heimat- und Palitzsch-Museum Prohlis
Im Heimat- und Palitzsch-Museum Prohlis, Gamigstraße 24, wird noch bis 31. Juli die einzigartige Sonderausstellung Kometenfieber gezeigt. Im Zentrum der Ausstellung steht der Bauerngelehrte Johann Georg Palitzsch, der vor 250 Jahren als Erster die Wiederkehr des Halley’schen Kometen beobachtete. Leihgaben zur Astronomiegeschichte aus europäischen Sammlungen spannen einen Bogen von 10000 Jahren.
Das Schillerhäuschen
Dresdens kleinstes Museum, das Schillerhäuschen, Schillerstraße 19, begeistert die Dresdner und ihre Gäste schon seit mehr als 150 Jahren. Friedrich Schiller arbeitete hier am Manuskript des Don Carlos und vollendete die Ode „An die Freude“. Ab April bis September ist das Museum jeweils samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Städtische Galerie Dresden
Wilsdruffer Straße 2, präsentiert in der Ausstellung Dresdner Meisterwerke einen Streifzug durch die lokale Kunst des letzten Jahrhunderts. Der „Bilderbogen“ spannt sich von Gemälden Gotthardt Kuehls über Werke von Otto Mueller und Otto Dix bis zu Arbeiten von Curt Querner, Willy Wolff und Thomas Scheibitz. Ab 12. Juni wird die Ausstellung hinsehen – Malerei und Zeichnung von Gerda Lepke gezeigt.
Das Stadtmuseum Dresden
Nur wenige Meter von der Dresdner Frauenkirche entfernt befindet sich das Stadtmuseum Dresden, Wilsdruffer Straße 2. Vier Säle, mehr als 1000 Exponate und über 20 Medienstationen schaffen unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit 800 Jahren Dresdner Geschichte zu beschäftigen. Ferner zeigt das Museum eine Ausstellung zum Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Parallel dazu ist ab Juli die Sonderausstellung Keine Gewalt! – Revolution in Dresden 1989 zu sehen.
Die Technischen Sammlungen Dresden
Junghansstraße 1–3, zeigen wertvolle Objekte sächsischer, deutscher sowie internationaler Industrie- und Technikgeschichte aus den letzten 150 Jahren. Ein besonderes Highlight ist das Erlebnisland Mathematik, das ab 7. April um einen neuen Ausstellungsteil ergänzt wird, das „Epsilon“ – ein Erlebnisland für Kleine.
Information: Museen der Stadt Dresden
Wilsdruffer Strasse 2
01067 Dresden
www.museen-dresden.de
Macht des Wortes – Benediktinisches Mönchtum im Spiegel Europas
In einer Zeit der Hektik und der Allgegenwart des Begriffs Krise suchen die Menschen in ihrem Alltag nach Oasen. Stille ist wieder gefragt, um den Stress der Berufswelt und den Leistungsdruck hinter sich zu lassen. Gerade in Zeiten wie diesen mag man
sich vielleicht die berechtigte Frage stellen: Wozu Ausstellungen und Kulturveranstaltungen?
Macht des Wortes – Benediktinisches Mönchtum im Spiegel Europas nennt sich die Ausstellung im Stift Sankt Paul, die sich der Entwicklung der Klöster widmet. Eine faszinierende Welt! Manches ist der Sprache unserer Zeit fremd. Vieles aber wird als bekannt empfunden und kann Denkanstöße für das eigene Leben vermitteln, vielleicht auch den Optimismus wecken.
Die Wirren der Völkerwanderung hatten in Europa ein Chaos hinterlassen. Kein Stein war auf dem anderen geblieben, und die Machtverhältnisse hatten sich grundlegend verschoben. Es war eine Zeit des Umbruchs – heute würde man es Krise nennen. In dieser Zeit wurde im Jahr 480 in einem kleinen Städtchen Umbriens namens Nursia Benedikt als Sohn wohlhabender Eltern geboren. Zunächst beherrschte eine glänzende Ausbildung das Leben des jungen Benedikt. Er wurde nach Rom geschickt, wo er sich im Studium das Rüstzeug für seine Zukunft erwerben sollte. Benedikt floh aus Rom und zog sich in die Einsamkeit von Enfide zurück. Der Ruf seines heiligmäßigen Lebens verbreitete sich rasch, sodass ihn die Mönche des Klosters von Vicovaro zu ihrem Abt wählten. Allein die Konsequenz und die Strenge Benedikts führten zum Bruch. Nach einem gescheiterten Vergiftungsversuch ging Benedikt nach Subiaco, wo er neuerlich die Einsamkeit suchte. Doch auch hier konnte sein stilles Streben nach den Werten des Lebens nicht verborgen bleiben, und immer mehr junge Männer kamen und schlossen sich ihm an, sodass bald 12 Klöster entstanden, denen Benedikt vorstand. Schließlich war es die Eifersucht des ortsansässigen Priesters Florentius, die Benedikt veranlasste, Subiaco zu verlassen. 529 gründete er das Kloster Montecassino, das zur Keimzelle des abendländischen Mönchtums wurde. Hier verfasste er seine Regula,
die als Lebensfibel Millionen von Mönchen und Nonnen durch viele Jahrhunderte begleiten sollte. Papst Gregor der Große schildert im zweiten Buch der Dialoge die Lebensgeschichte des Heiligen und überlieferte damit die Biografie einer der schillerndsten Persönlichkeiten am Ausgang der Antike. Und was dieser Benedikt von Nursia zu sagen hat, ist heute noch gültig.
Mit großem Aufwand wurde die Kärntner Benediktinerabtei saniert. Die bedeutende Sammlung der Bücher, die Handschriften ab dem 4. Jahrhundert verwahrt, ist in den alten Kellergewölben zu einer beeindruckenden Welt der Literatur zusammengetragen worden.
Herausragende Werke, wie das älteste Buch Österreichs oder das erste Druckwerk Gutenbergs, werden in der Ausstellung ebenso gezeigt wie die berühmten Merseburger Zaubersprüche, die das erste Mal im Original außerhalb Merseburgs zu sehen sein werden. Nicht zuletzt stehen sie als Synonym für das Verbotene. Heute haben die Menschen freien Zugang zu Wissen und geistigen Errungenschaften. Das war nicht immer so.
Alle Kellergewölbe im Westtrakt des Stifts sind nun der Öffentlichkeit zugänglich, und es wird möglich, Architektur von fast 1000 Jahren zu erspüren. Weit ausladende Hallen, kleine Verliese und geheime Gänge … all das gibt es nicht nur
in spannenden Filmen, sondern das wird in Sankt Paul Wirklichkeit. Gewaltige Mauern von drei Meter Stärke, riesige Bogen und mächtige Pfeiler modellieren eine „Landschaft“, die den Atem stocken lässt. Was war hier vor Hunderten von Jahren? Wer hat das alles gebaut?
Außen erahnt man nicht, was sich im Inneren des Klosters verbirgt, und man ist überrascht von der Weitläufigkeit des Ensembles.
Im Blickpunkt der Ausstellung steht die älteste erhaltene Abschrift der Benediktusregel aus Sankt Gallen, um die sich eine Fülle von beeindruckenden Exponaten aus ganz Europa gruppiert. Die berühmte Arche des Willibrord, der Codex Benedictus aus dem Vatikan, das Gandersheimer Evangeliar aus Coburg, die Millstätter Genesis und nicht zuletzt ein von Martin Luther handgeschriebenes Werk sind Glanzlichter dieser Schau. Neben den Kostbarkeiten der Buchkunst zeigt das Stift Sankt Paul in der Europaausstellung aber auch hervorragende Gemälde und Grafiken vieler bedeutender Künstler und Werke aller wichtigen Silber- und Goldschmiede Europas.
In der Ausstellung werden aber nicht ausschließlich spirituelle Themen beleuchtet, sondern es wird deutlich, dass die Benediktiner großen Anteil an der Gestaltung Europas in vielfältigen Bereichen hatten. Die Kultivierung der Landschaft, der Bergbau, Entdeckungen und Erfindungen waren durch einen aufgeschlossenen Geist, der die Klöster über Jahrhunderte durchwehte, möglich. Es gab faszinierende Persönlichkeiten, die ihre Zeit prägten.
Kristalldom
Die Inszenierung der Schöpfungstage und des Lebens des heiligen Benedikt durch Peter Hans Felzmann in einer atemberaubenden Kellerwelt versetzt den Besucher in Staunen und entführt ihn in eine andere Zeit. Der Kristalldom stellt sich als eines der Highlights der Europaausstellung dar, lädt im Planetarium zum Träumen ein und gebietet Ehrfurcht vor der Virtuosität der Architektur des Mittelalters.
Barockgarten und Kräutergarten
Wer jedoch dem Stress des Alltags entfliehen möchte, kann sich im historischen Barockgarten bei einer Tasse Kaffee im Gartenschlössl Belvedere erholen und den Ausblick und die Ruhe im „Paradies Kärntens“ genießen. Bestimmt ist gegen die Hektik dieser Zeit auch ein Kraut gewachsen, vielleicht findet man dieses sogar im neu angelegten Kräutergarten oder in einem der Tees, die in der eigenen Kräuterapotheke zum Verkauf angeboten werden.
Kinderprogramm
Nicht vergessen hat man im Stift Sankt Paul auf die kleinen Gäste. So begeben sich die Kinder gemeinsam mit dem Klosterkobold Muki auf Entdeckungsreise und können nach erfolgreicher Rätselrallye eine kleine Überraschung im Museumsshop abholen. Und während die Erwachsenen durch die spannende Ausstellung spazieren oder bei einem guten Gläschen Stiftswein im Restaurant entspannen, können sich die ganz Kleinen in der Kinderbetreuungsstätte vergnügen.
Macht des Bildes
Der „Macht des Wortes“ wird im Werner-Berg-Museum in Bleiburg die „Macht des Bildes“, die Fähigkeit der Bilder, in der Erscheinung Sinn und Bedeutung zu schaffen, gegenübergestellt. Herausragende Kunstwerke unserer Zeit bieten eine anschauliche Ergänzung zu den in Sankt Paul behandelten historischen Zeiträumen. Der Besucher erfährt, wie große österreichische Künstler des 20. Jahrhunderts Visionen von Transzendenz und Göttlichkeit in ihren Bildern zu zeigen vermochten. Der Bogen der über 50 ausgewählten Künstler reicht von Alfred Kubin, Egon Schiele und Oskar Kokoschka über Herbert Boeckl, Max Weiler und Arnulf Rainer bis zu Hermann Nitsch. Die Fülle der ausgewählten Werke ergibt gleichzeitig einen eindrucksvollen Überblick über die Geschichte der österreichischen Moderne. Wie haben die Künstler, jeder Einzelne von ihnen, Göttlichkeit erlebt? Dies wird zur zentralen Frage der Ausstellung. Besondere Berücksichtigung erfährt dabei das im Museum sonst beheimatete Werk Werner Bergs.
Erstmals zeigt der neue Skulpturengarten Meisterwerke zeitgenössischer Bildhauerkunst.
Beim Tanzfestival, in dem ein eigens für diesen Zweck geschaffenes Werk von Johann Kresnik und Karlheinz Miklin zur Uraufführung kommt, wird Bleiburg zum Zentrum aktuellster performativer Kunst.
Europafeste sowie kulinarische Kostbarkeiten veredeln das Angebot der Europaausstellung, die auf diesem Weg zwei Regionen miteinander verbindet und den Begriff Europa neu interpretiert.
Informationen
Europaausstellung 2009
26. April bis 8. November 2009
täglich 10–18 Uhr
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Junge Kunst hinter alter Fassade
Noch bis 26. April präsentiert das Graphikmuseum mit Helmut Newton den unerreichten Großmeister der Aktfotografie. Seine Bilder sprengten in den 1960er-Jahren die Grenzen der traditionellen Werbefotografie. Wie kein anderer spielt Newton in seinen Werken mit weiblichen Rollenmustern und Klischees, er inszeniert meisterlich den voyeuristischen Blick auf den weiblichen Körper.
Für den Betrachter des 21. Jahrhunderts liefern die rund 130 Werke der Ausstellung Die Zukunft der Vergangenheit (1. Mai bis 7. Juni 2009) anschlie-ßend eine ungewohnte und überraschende Sichtweise auf die Fotokunst des 19. Jahrhunderts. Denn nicht die historische Entwicklung der Fotografie steht im Vordergrund der Schau, sondern die Frage, inwieweit Bildstrategien des 20. Jahrhunderts bereits in Bildern des 19. Jahrhunderts zu sehen sind.
Anschließend widmet sich das Museum vom 14. Juni bis 16. August dem 100. Geburtstag des Grafikers Helmut Andreas Paul Grieshaber (1909–1981), der unter seinem Kürzel HAP nach dem Zweiten Weltkrieg federführend zur künstlerischen Erneuerung des Holzschnitts beitrug. Zeitgleich präsentiert die Ausstellung Inventur einen Überblick über das zeitgenössische künstlerische Schaffen im Bereich der Radierung an deutschen Hochschulen. Die Präsentation verdeutlicht die ganze Spannbreite unterschiedlichster künstlerischer Handschriften und Stile und die zahlreichen Möglichkeiten der Radiertechnik.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Arik Brauer und die Bibel
Gezeigt werden Werke vom Anfang der 1960er-Jahre bis zur Gegenwart, die Geschichten aus der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, erzählen. Arik Brauer ist einer der prominentesten Vertreter der Wiener Schule des fantastischen Realismus. Die Auseinandersetzung des Künstlers mit religiösen Inhalten ist eine Folge der Reflexion seiner Lebensgeschichte. Im Jahr 1929 als Sohn eines jüdischen Handwerkers in Ottakring geboren, ist er einer der wenigen Überlebenden des nationalsozialistischen Regimes in Wien. Die Geschichte und das Schicksal des jüdischen Volks nehmen in Brauers Schaffen eine zentrale Rolle ein. Die Beschäftigung damit ist sein persönlicher Beitrag zum jüdisch-christlichen Dialog.
Brauers Malerei ist jedoch nicht nur als rein figurativ erzählende aufzufassen, hinter der handwerklich altmeisterlichen Technik der Schichtenmalerei steht vor allem auch eine subtile Botschaft, die geheimnisvoll verschlüsselt übermittelt wird und die Fantasie des Betrachters anregt. So symbolisiert das Bild Der goldene Götze (1964), wie sich die Menschen von der Macht des Geldes allzu leicht blenden lassen. Brauers Kunst, sein Streben nach Harmonie zeigen sich eindringlich im Werk Der bunte Todesengel (1997), in dem der Tod „kein Gerippe und auch kein schwarzer Rabe“ ist, sondern als „farbenfroher, prächtiger Augenblick“ dargestellt wird.
Neben der Ausstellung im Dommuseum ist als weiteres Symbol der Wertschätzung seitens der katholischen Kirche für den Künstler ein Bauwerk hervorzuheben: die Außenfassade der katholischen Pfarrkirche Am Tabor in Wien. Sie wurde nach einem Entwurf Brauers im Jahr 1995 neu gestaltet, stellt das „Letzte Abendmahl“ mit Symbolen des jüdischen Passahfests dar und ist somit ein besonderer Ausdruck des Dialogs beider Religionen.
Für Arik Brauer stellt die Bibel nicht nur eine bedeutende künstlerische Inspirationsquelle dar, vielmehr noch sieht er sie selbst als „ein überragendes Kunstwerk“.
bis 20. Juni 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Maria Lassnig. Das neunte Jahrzehnt
Gemalte Körperempfindungen
In den letzten Jahren ist Maria Lassnig endgültig der internationale Durchbruch gelungen. Die Künstlerin gilt nachfolgenden Generationen zu Recht als Vorreiterin und Visionärin, die den Diskurs und die Entwicklung der Malerei seit Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Im Zentrum ihres Schaffens steht seit 60 Jahren die Künstlerin selbst beziehungsweise das, was sie ihre „Körperempfindung“ nennt: „Es ist sicher, ich male und zeichne nicht den ‚Gegenstand‘ Körper […], sondern ich male Empfindungen vom Körper“ (Maria Lassnig, 1999). Ihre Malerei zeigt einerseits die kompromisslose Offenlegung des eigenen Körpers und der eigenen Befindlichkeit, zum anderen vermittelt sie den Blick von außen und ermöglicht damit die scheinbar objektive Darstellung gleichzeitig existierender Körperwahrnehmungen.
Maria Lassnig, die sich gern mit der Aura der Einzelgängerin umgibt und von sich selbst sagt, dass sie „gern böser“ wäre, hat es wie wenige andere Künstler verstanden, sich in verändernden gesellschaftlichen Kontexten immer wieder aufs Neue zu bewähren.
Die Ausstellung wirft einen fokussierten Blick auf „das neunte Jahrzehnt“ von Maria Lassnigs Schaffen. In den vergangenen Jahren entwickelte sich ihr Werk immer konfrontativer und direkter, wobei die Künstlerin frühere Themen aktualisiert und variiert, ohne sich jedoch zu wiederholen. Eine große Rolle spielt dabei die Erinnerung, wie Maria Lassnig betont: „Die Außenwelt dringt so sehr auf einen Menschen ein, dass man eigentlich gar nichts anderes darstellen könnte.“
Zeichnen mit dem Pinsel
So bezieht sich Maria Lassnig erneut auf die Verknüpfungen von Menschlichem und Animalischem, indem sie in einer Serie aus dem Jahr 2000 Meerschweinchen, Frösche, Vögel oder Affen umarmt und mit ihnen kokettiert. Auch mystische Elemente finden sich in ihren neuesten Arbeiten.
In den sogenannten „Kellerbildern“ hüllte sie Modelle in Plastikfolien, um die Körper neu zu empfinden und Situationen psychologisch zu deuten. Bereits in den frühen 1970er-Jahren malte Maria Lassnig ein Selbstporträt mit Folie sowie ein Stillleben mit zellophanierten Äpfeln, nachdem sie in einem amerikanischen Supermarkt erstmals in Folie verpacktes Obst gesehen hatte.
Eine Gruppe von „Erinnerungsbildern“ führt Lassnig bis in ihre Akademiezeit zurück. Maria Lassnig gestaltete einen Adam und Eva-Zyklus, in dem sie das Verhältnis der Geschlechter als zärtlich-erotische wie auch als aggressiv-feindselige Beziehungen thematisiert. Auch an ihre Strichbilder aus den 1960er-Jahren, in denen sie auf formal reduzierter Weise das „Zeichnen mit dem Pinsel“ mit verschlüsselt surrealen und auch heiter-burlesken Inhalten verband, knüpft Lassnig in ihren neuen Arbeiten an.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Die ganze Welt der Eisenbahn
Die Sammlungen des Hauses gehören zu den größten verkehrsgeschichtlichen Beständen der Welt: über 10000 Exponate, zirka 70000 historische Grafiken, rund eine Million Fotos, eine Bibliothek mit 40000 Bänden, eine einzigartige Sammlung von 180 Modellen im Maßstab 1:10 und mehr als 120 Originalfahrzeuge, von denen etwa 30 in Nürnberg ausgestellt sind.
Das Herzstück des DB Museums bildet eine Schau über die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Über zwei Jahrhunderte Eisenbahngeschichte mit all ihren Beziehungen zu Technik und Wirtschaft werden den Besuchern spannend und zeitgemäß in einer multimedialen Inszenierung präsentiert. Am Anfang des Rundgangs steht ein originaler englischer Kohlenwaggon von 1829. Im „Adlerama“ erzählt ein Film die Entstehung der ersten deutschen Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Weiter führt der Rundgang durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, vorbei an Reisenden der Kaiserzeit und den eindrucksvollen Kulissen Berlins um 1900, bis der Siegeszug der Eisenbahn in das Grauen des Ersten Weltkriegs mündet. Auf die innovativen Jahre der Weimarer Republik, in der die Reichsbahn gegründet wird, folgen die schwärzesten Jahre der deutschen Bahngeschichte, als die Bahn sich zum logistischen Rückgrat der Verbrechen des Nationalsozialismus machen lässt. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs fährt die wiederaufgebaute Bahn auf getrennten Gleisen im geteilten Deutschland weiter. Nach dem Fall der Mauer entsteht schließlich wieder eine gesamtdeutsche Eisenbahn.
Mit der Eisenbahn-Erlebniswelt ist ein „Museum zum Anfassen“ verwirklicht worden. Auf rund 1000 Quadratmetern können kleine und große Eisenbahnfans ihrer Leidenschaft frönen. Begehbare Tunnel und Bahnübergänge, Signale und Weichen, die bewegt werden können, ein Bobby-Train-Parcours, interaktive Spiele zu Themen wie Umweltschutz und Logistik, Fahrsimulator und Mitfahrt auf dem Führerstand sowie die große Modellbahn sind die wichtigsten Bestandteile dieses lebendigen Museums.
Seit Ende Mai 2007 erstrahlt die Fahrzeughalle im Hauptgebäude in neuem Glanz: Ein Dutzend „Legenden der Schienen“ sind hier versammelt, vom Nachbau des „Adlers“ über Deutschlands älteste Originallokomotive bis hin zur Rekordlokomotive S 2/6. Höhepunkt ist hier der berühmte Nachbau der Lokomotive „Adler“, Deutschlands erster Dampflokomotive. Die originalen Salonwagen von Fürst Bismarck und dem bayerischen Märchenkönig Ludwig II. sind auf dem neuen Fürstenbahnsteig wirkungsvoll in Szene gesetzt.
Das Angebot der permanenten Ausstellungen wird durch ein vielfältiges Sonderausstellungs- und Veranstaltungsprogramm ergänzt. Ab Juli 2009 läuft die Sonderausstellung Logistik, die den DB-Konzern im Geflecht des globalisierten Warenverkehrs zeigt.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Das Leben in Roms Donaumetropole
Großes Carnuntiner Römerfest
Am 6. und 7. Juni herrscht in Carnuntum, der römischen Metropole an der Donau, der Ausnahmezustand: Rund 200 römische Teilnehmer – bestehend aus Legionstruppen und Gladiatoren, Handwerkern und Händlern – haben wieder ihr Lager im Archäologischen Park Carnuntum aufgeschlagen. Es beginnt ein Spektakel, das die Besucher in eine Zeit versetzt, die gut 2000 Jahre in die Vergangenheit führt. Triumphzüge römischer Legionen führen dem gespannten Publikum vor Augen, was sich in der Antike an diesem Ort zugetragen hat. Auf dem ganzen Gelände bieten Handwerker und Händler ihre Waren feil. Die Kunst des Kochens nach antiken Rezepten trägt dazu bei, das alte Carnuntum mit allen Sinnen erfahren zu können.
Bei dieser Zeitreise darf aber auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Erlesene Köstlichkeiten, nach überlieferten römischen Rezepten hergestellt, und Spitzenweine aus der Region Carnuntum entführen in die sinnliche Welt römischer Genusskultur.
Junge Römer sind eingeladen, mit Julius Carnuntinus auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise durch Carnuntum zu gehen. Bei dieser speziellen Julius-Tour gilt es, allerlei Sonderprüfungen zu bestehen und dem aufregenden Leben eines reichen Römers auf die Spur zu kommen. Dazu haben Kinder die Möglichkeit, sich im Exerzieren zu üben, ein römisches Schwert zu basteln, alten Märchen und Sagen zu lauschen und vieles mehr.
6. und 7. Juni 2009, 10–18 Uhr
Freilichtmuseum Petronell
Gladiatoren in der Arena
Im Jahr 2009 kehren die Gladiatoren wieder nach Carnuntum zurück. Die Vorführungen im Amphitheater Bad Deutsch-Altenburg zeigen, wie der Ablauf von antiken Gladiatorenkämpfen wirklich war. Ausrüstung und Kampftechnik wurden bis ins kleinste Detail rekonstruiert und geben fesselnde Einblicke in die Welt der Arena.
Gladiatorenkämpfe waren ein elementarer Bestandteil der römischen Kultur. Ursprünglich Teil des etruskischen Totenkults, mutierten die Gladiatorenkämpfe unter den Römern zu jenen blutrünstigen Spektakeln, die wesentlich unser Bild von der römischen Antike prägen. Auch in Carnuntum kämpften Gladiatoren vor bis zu 8000 Zusehern auf Leben und Tod. Anders als in Kinofilmen dargestellt, waren die Kämpfe nicht immer ein Massengemetzel, sondern Zweikämpfe mit festgelegten Regeln und fixen Waffengattungen. Verachtet und umjubelt zugleich, führten die antiken Gladiatoren ein Leben zwischen Familie und Arena.
Die Vorführungen der Gladiatoren rund um Marcus Junkelmann beginnen wie schon zur Zeit der Römer mit dem feierlichen Einzug der Gladiatoren zu originalgetreuer römischer Musik. Vor den kommentierten Schaukämpfen wird nach einer überlieferten, jahrtausendealten Zeremonie die Schutzgöttin Nemesis um ihre Gunst angerufen. Danach erfolgt die Bewaffnung der Gladiatoren.
20./21. Juni, 18./19. Juli, 22./23. August 2009,
jeweils um 14 und 16 Uhr, Amphitheater
Bad Deutsch-Altenburg
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Nord Art – Kunst in der Carlshütte
„Kunst in der Carlshütte“ (KiC) heißt das Kunst- und Kulturforum, das hinter der großen wie großartigen Ausstellung steckt und eine gemeinsame Initiative der ACO-Gruppe sowie der beiden benachbarten Städte Büdelsdorf und Rendsburg ist. Als die alte Gießerei, einst das erste Industrieunternehmen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, 1997 nach 170 Jahren Produktion stillgelegt wurde, verpflichtete das historische Ensemble geradezu dazu, es nicht brachliegen zu lassen, sondern seine Geschichte weiterzuerzählen. Doch dass die vergleichsweise kleinen Ausstellungen in der Wagenremise nur der Anfang zu einer großen in-ternationalen Kunstausstellung sein würden, ahnte damals niemand. Selbst die beiden Männer nicht, welche die treibenden Kräfte des Kulturforums sind: der geschäftsführende ACO-Gesellschafter Hans-Julius Ahlmann und der Maler und Bildhauer Wolfgang Gramm.
Die Bühnen, die KiC bespielen kann, sind einzigartig. Um einen 60000 Quadratmeter großen innerstädtischen Park aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts gruppieren sich das unter Denkmalschutz stehende Direktorenhaus der Carlshütte, charmante Gebäude wie die mehr als 100 Jahre alte Wagenremise, die Alte Meierei, die seit zwei Jahren als Café dient, und natürlich die ehemalige Eisengießerei mit ihren 20000 Quadratmeter großen Hallenschiffen und dem gewaltigen Kupolofen.
KiC lädt regelmäßig zu Kunstausstellungen, Konzerten, Lesungen, Theater- und Filmvorführungen ein. Herausragend aber ist die international besetzte Nord Art, die jeden Sommer einen Überblick über aktuelle Arbeiten aus allen Medien der bildenden Kunst gibt. Auch für 2009 haben sich mehr als 1200 Künstler aus aller Welt beworben, von denen gut 200 ihre Werke zeigen. Die Nord Art hat sich zur größten jährlichen Kunstausstellung in Nordeuropa entwickelt. Und sie hat es darüber hinaus geschafft, die gesamte Region für die Kunst zu begeistern: Öffentliche Plätze und der Skulpturenpark verwandeln sich im Sommer in imposante Open-Air-Galerien für Stein- und Stahlskulpturen, und zu den vielen Tausend Besuchern, die jedes Jahr zur Nord Art kommen, gehören auch solche, die sich selbst als ungeübte Kunstbetrachter verstehen, aber durch das Ambiente ganz offensichtlich verführt werden, ihre Befangenheit abzulegen.
Jeweils Mitte Mai, im Vorfeld der Nord Art, richtet KiC ein Symposium für Steinbildhauer aus, die vor Ort ihre Skulpturen für die Nord Art erarbeiten. Parallel dazu wurde 2008 auch erstmals jungen Malerinnen angeboten, auf der Nord Art für die Nord Art zu arbeiten. Denn auch das hat sich KiC zum Ziel gesetzt: Anfänger und Etablierte zusammenzubringen, Künstlernetzwerke über Ländergrenzen hinweg knüpfen zu helfen – eine Idee, die sich auch deutlich im Ausstellungskonzept widerspiegelt.
Nicht jedes Kunstwerk wird alle Besucher ansprechen, manche Idee überhaupt kein Verständnis finden und dann wieder eine den Betrachter mitten in Herz und Seele treffen. Aber auf jeden Fall kann KiC ungewohnte Perspektiven und neue Begegnungen mit der Kunst versprechen. Die Nord Art wurde 2008 von der Standortinitiative „Land der Ideen“ ausgezeichnet.
Nord Art 09
13. Juni bis 27. September 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Neue Bestmarken für die art KARLSRUHE
„Jetzt ist die Messe perfekt“, gab sich Messekurator und Projektleiter Ewald Karl Schrade begeistert vom Verlauf der sechsten art KARLSRUHE. 40200 Besucher, über fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr, wurden 2009 gezählt. „Es hat sich wieder einmal bewahrheitet, dass behutsames Wachstum und kontinuierlicher Feinschliff an der Qualität und dem Service sich auszahlen“, erläuterte Schrade. Aussteller und Besucher waren gleichermaßen beeindruckt von der „schönsten und größten Galerie in Süddeutschland“. Dass sich dies in den Umsätzen der Kunsthändler spiegelte, ist ein weiteres positives Resultat. Viele Verkäufer winkten beim Erwähnen des aktuellen Reizworts „Krise“ schlicht ab. Schon die Vernissage setzte Zeichen. Kulturstaatsminister Bernd Neumann sorgte mit der Bekanntgabe, die Ankaufskommission des Bundes werde vom nächsten Jahr an Karlsruhe ansteuern, für einen Paukenschlag. Damit liegt die Messe auf einer Reiseroute mit Basel, Berlin, Köln und London.
Die art KARLSRUHE ist nach wie vor ein Magnet für alle Kunstfans. So wundert es nicht, dass neben Frieder Burda und dem Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG, Wendelin Wiedeking, auch der Kunstsammler Rüdiger Hurrle sowie der langjährige Moderator der ZDF-Kultursendung Aspekte, Manfred Eichel, vor Ort waren. Größen aus der Museumslandschaft wie der Frankfurter Städel-Direktor Max Hollein und Stuttgarts Staatsgalerie-Direktor Sean Rainbird statteten der Messe ebenfalls einen Besuch ab. Klaus Schrenk, ehemals Leiter der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, seit Kurzem Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, blieb dem Standort treu und reiste aus München an. Die positive Stimmung bei Käufern und Verkäufern herrschte über den gesamten Zeitraum. „Es kommen in diesem Jahr sehr viele Besucher“, resümierte Siegfried Sander, Multiple Box, Hamburg. „Wir haben ausgezeichnete Gespräche geführt, unsere Kunden sind uns treu.“ Dabei war das Interesse an Werken aus moderaten und oberen Preisklassen ungebrochen.
Wieder einmal bewiesen Henze und Ketterer feines Gespür für ihre Kunden. Die Umsätze überschritten weit die Million. Neben einem Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner vermittelten die Händler aus Wichtrach/Bern Werke von Hans Hartung, Max Pechstein, Christian Rohlfs und Karl Schmidt-Rottluff. Aber auch Kollegen meldeten Erfolge: Die Wuppertaler Galerie Epikur empfing Kunden aus Köln und verkaufte insgesamt 30 Bilder. Begehrt waren die fragilen Naturformen von Marina Schreiber. Zehn Objekte, feine Gespinste aus elektronischen Bauteilen, fanden Abnehmer. Dierk Lemcke, Verlag St. Gertrude, Hamburg: „Die Rezession spüren wir im Grunde nicht.“ Ein Tableau von Daniel Spoerri konnte er veräußern. Besonders zufrieden war er mit seinen Besuchern: „Die Verweildauer vor den Bildern ist sehr groß.“ Walter Bischoff, Berlin, zog ebenfalls positive Bilanz. Zwei One-Artist-Shows zu Dennis Ekstrom und Joachim Hiller rahmten seinen Stand, an dem unter anderem Bilder von H. P. Zimmer und Helmut Sturm neue Besitzer fanden. Dorothea van der Koelen, Mainz/Venedig, freute sich über „faktisch neue Kunden durch die Messe, die bis zu 30000 Euro ausgegeben haben“. Überdies sei es ein hervorragendes Zeichen, dass immer mehr traditionsreiche Galerien Karlsruhe als Handelsplatz aufsuchen. Beste Voraussetzungen also für die kommende art KARLSRUHE, die vom
4. bis 7. März 2010 stattfinden wird.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Peter Zimmermann. All You Need
Mit dem Aufkommen neuer Bildtechnologien, der sogenannten neuen Medien, wurden sowohl politische und gesellschaftliche als auch künstlerische Paradigmen in Bezug auf visuelle Systeme verhandelt. Seit Mitte der 1980er-Jahre nimmt Peter Zimmermann (Jahrgang 1956) in seiner künstlerischen Produktion Bezug auf den aktuellen Diskurs um eine adäquate Konstruktion von zeitgenössischer Kunst. Die Fragen kreisen um den Kunstbegriff, die Produktion und Rezeption von Kunst sowie die Authentizität künstlerischer Autorschaft.
In der Ausstellung All You Need versammeln sich Arbeiten aus insgesamt 20 Jahren künstlerischer Praxis: Malerei – von den Book Cover Paintings über die in Epoxidharz gegossenen Großformate hin zu aktuellen Spraybildern –, dreidimensionale Objektskulpturen und eigens für die Ausstellung konzipierte Raum- und Wandinstallationen.
Der gemeinsame Nenner dieser unterschiedlichen Arbeiten liegt in der Reflexion der kulturellen Definitionsmacht visueller Systeme. Dabei zeichnen sich zwei Strategien ab: Während die frühen Arbeiten von der Mitte der 1980er- bis zur Mitte der 1990er-Jahre vor allem auf dem Konzept des Coverns und der Simula-
tion basieren, beruhen die zahlreichen seit Mitte der 1990er-Jahre entstandenen sogenannten Blob Paintings auf einer Computerbearbeitung der Bildmotive.
In den frühen Arbeiten, wie den gemalten Buchtiteln der 1980er-Jahre, setzt sich Peter Zimmermann mit dem traditionellen Kunstbegriff auseinander, indem er gedruckte Vorlagen wirkungsvoll ins Medium der Malerei übersetzt und dem Bild einen objekthaften Status verleiht. In den großformatigen Reproduktionen von Ausstellungskatalogen Jackson Pollocks thematisiert er in der Folge die gesellschaftliche Rezeption von Kunst. Er legt die Mechanismen offen, die für die Festschreibung von Status und Bedeutung von Kunst im institutionellen Rahmen von Museen und Galerien wichtige Instrumente darstellen.
Die späteren Bilder, die in Epoxidharz gegossenen Blob Paintings und die aktuellen Spraybilder, bauen auf einer Transformation digitaler Vorlagen auf. Dabei wählt Peter Zimmermann aus seinem elektronischen Archiv, in dem er Bildmaterial aus verschiedenen Informationsmedien speichert, Sujets aus, die er mehrfachen Bildbearbeitungsprozessen unterzieht. Das künstlerische Bild gewinnt seine genuine malerische Qualität in der Übertragung des digitalen Konzepts auf die Leinwand. Die Malerei erscheint in opulenter, sinnlicher Materialität, und die Bilder treten als verführerisch glänzende Ereignisse hervor.
Die übergroßen Objektskulpturen aus Kunststoff sind als Transformation der bildnerischen Arbeiten ins Dreidimensionale zu werten. Auch sie beruhen auf jenen in Fülle vorhandenen digitalen Bildmotiven, die einem Verwandlungsprozess unterzogen werden. Virtual Sculpturing erlaubt es, einen virtuellen Körper mit virtuellen Werkzeugen vollkommen frei zu gestalten. Den Raum beanspruchend, gebärden sich die Objekte wie Wesen aus einer anderen Sphäre, das Artifizielle an ihnen wird durch die glatten und makellosen Oberflächen noch unterstrichen. Auch hier definiert die souveräne Verbindung aus künstlerischer Technik und industrieller Hightech Zimmermann als Autor einer zukunftsweisenden hybriden Ästhetik.
bis 14. Juni 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.













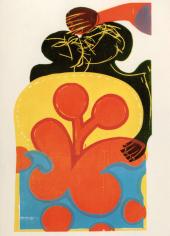





























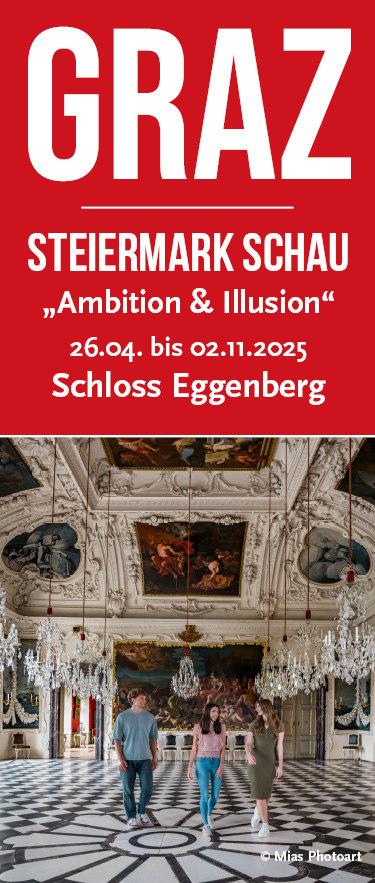







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.