Tickets und Infos Künstler der Galerie
Denkmale für die Arbeit. Wirtschaftsgeschichte im Spiegel der Medaillenkunst
Die Form der Medaille spiegelt als handliches Erinnerungszeichen – vom anspruchsvollen Kunstwerk bis hin zum einfach gestalteten Souvenir – die wirtschaftliche Entwicklung und unternehmerisches Handeln vor allem im 19. und 20. Jahrhundert in besonderer Weise.
Die Medaillen verewigen die Entwicklung von Unternehmen, den Wandel des Bildes (des) vom Arbeiter(s) sowie vom (des) Unternehmer(s), ihrer Erfolge und Verdienste. Die Medaille ist damit eine künstlerische und wirtschaftshistorische Quelle. In einer Auswahl aus der Sammlung des Landesmünzkabinetts Sachsen-Anhalt präsentiert die Stiftung Moritzburg von … bis … signifikante Denkmale der Arbeitswelt aus unterschiedlichen Branchen. Zeugnisse der mitteldeutschen und halleschen Wirtschaftsgeschichte stehen im Mittelpunkt. Dazu gehören Preismedaillen von der halleschen Maschinenbaufirma F. Zimmermann, die erstmalig öffentlich gezeigt werden. Sie wurden auf den verschiedensten Messen in Europa errungenen und von der Tochter des Firmengründers bereits im Jahr 1894 dem Museum gestiftet.
Veranstaltungsvorschau: Denkmale für die Arbeit. Wirtschaftsgeschichte im Spiegel der Medaillenkunst - Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public": Verstaubt, Verschroben, oder doch von dieser Welt?
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Mag. Dominique Zimmermann.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public": Verstaubt, Verschroben, oder doch von dieser Welt? - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public": Lurche und Kriechtiere Wiens
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Dr. Heinz Grillitsch.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public": Lurche und Kriechtiere Wiens - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public": Die Schlangenfauna Nordafrikas
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Dr. Heinz Grillitsch.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public": Die Schlangenfauna Nordafrikas - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Annie Leibovitz - A Photographer's Life 1990-2005
"Annie Leibovitz: A Photographer’s Life 1990 – 2005" umfasst mehr als 150 Fotografien, davon viele großformatige Werke, sowie eine Anzahl von privaten Fotos. Zahlreiche Sequenzen beziehen sich auf ihre Eltern und zeigen Familientreffen und Reisen ans Meer. Und unvermittelt sieht man sich immer wieder mit Berühmtheiten konfrontiert, die Annie Leibovitz mit erstaunlicher Unmittelbarkeit porträtiert: Bill Clinton, Nelson Mandela, Demi Moore, Jack Nicholson, William Burroughs und viele andere. Die Werke von Leibovitz in dieser Ausstellung strahlen eine emotionale Kraft aus, die das bisherige Oeuvre der Fotografin in den Schatten stellt.
Annie Leibovitzs Foto-Ikonen, die das vielfältige Spektrum des amerikanischen Lebens und der populären Kultur bemerkenswert freimütig und kraftvoll einfangen, sind seit den 1970ern sowohl in Magazinen wie "Rolling Stone","Vanity Fair" und "Vogue" als auch in prominenten Werbekampagnen erschienen und in Kunstmuseen ausgestellt worden.
"Annie Leibovitz: A Photographer’s Life 1990-2005" ist eine Ausstellung des Brooklyn Museums, New York, kuratiert von Charlotta Kotik, emeritierte Kuratorin für zeitgenössische Kunst.
Bereits im Jahr 1993 fand unter dem Titel "Annie Leibovitz: Photographs 1970 – 1990", eine Ausstellung dieser herausragenden Künstlerin statt, die mit mehr als 80.000 Besuchern in nur 10 Wochen ein großer Erfolg war.
Fotos:
Annie Leibovitz
Brad Pitt, Las Vegas, 1994
Photograph © Annie Leibovitz
Courtesy of Vanity Fair
From Annie Leibovitz: A Photographerʼs Life, 1990 – 2005
Annie Leibovitz, Café de Flore, Paris, 1997
Photograph by Martin Schoeller
Veranstaltungsvorschau: Annie Leibovitz - A Photographer's Life 1990-2005 - KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser
Keine aktuellen Termine vorhanden!Art Brut aus Japan
Jeder der präsentierten Künstler, die am Rande der japanischen Gesellschaft und oft auch in psychiatrischen Einrichtungen leben, hat sich durch seine Kunst eine eigene Welt hoher ästhetischer Intensität erschaffen. Die Künstler werden mit ihrer Malerei und Grafik, ihren Skulpturen und Plastiken ebenso präsentiert wie durch berührende Dokumentarfilme, die ihre Schicksale, Lebensumstände und Arbeitsweise vermitteln. "Art Brut aus Japan" wurde von der Collection de l'Art Brut in Lausanne, dem international renommierten Museum für Art Brut entwickelt.
Veranstaltungsvorschau: Art Brut aus Japan - KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser
Keine aktuellen Termine vorhanden!Künstler der Galerie
Mit Richters ungewöhnlichen Bildern zeichnete sich schon nach kurzer Zeit Erfolg und ein breites Echo auf ihr Schaffen ab.
Ernst Fuchs zählt zu den Gründern der Wiener Schule des Phantastischen Realismus.
Gotthard Fellerer ist bildender und ausbildender Künstler, Publizist, Spurensucher sowie begeisterter Kunstmultiplikator.
Karl Goldammer beeindruckt u.a. mit seinen Häuserbildern.
Schwerpunkt in den Werken des Bildhauers Hans Muhr ist das Lebenselement Wasser.
Veranstaltungsvorschau: Künstler der Galerie -
Keine aktuellen Termine vorhanden!Technik und Kunst
Sein weltweit einzigartiges Museumskonzept „Technik und Kunst“ ermöglicht es Frauen, Männern und Kindern, zwei Themenbereiche gemeinsam kennenzulernen und zu erleben, wie Kunst und Technik sich gegenseitig befruchten.
Hauptattraktion ist die begehbare originalgetreue Rekonstruktion des 33 Meter langen Teilstücks von LZ 129 Hindenburg von 1936. Sie vermittelt die Zeppelin-Begeisterung von damals und lässt die erste Weltumrundung vor 80 Jahren lebendig nachempfinden. Schon beim Einstieg über das Fallreep umfängt der Zauber der fliegenden Silberzigarre die Museumsgäste. Die zahlreichen Exponate aus der weltgrößten Sammlung zu Geschichte und Technik der Zeppelin-Luftschifffahrt veranschaulichen, wie um den Zeppelin herum die Schlüsseltechnologien zu Mobilität, Aerodynamik und Leichtbau mit noch heute gültigen Pionierleistungen geschaffen wurden.
Die Kunstabteilung spannt einen breiten Bogen über fünf Jahrhunderte: Die Besucher erleben Gemälde und Skulpturen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Ansichten des Bodensees, umfangreiche Sammlungen zu Otto Dix und Max Ackermann sowie die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Bei Künstlern wie Res Ingold berühren sich – ganz im Sinne des Grafen Zeppelin – Kunst und Technik, nämlich das Reich der Luft und das wagemutiger Gedankenexperimente.
Das Zeppelin Museum lockt mit immer neuen Wechselausstellungen und wöchentlichen Abendveranstaltungen. Für die jüngsten Museumsgäste werden Quizpakete, zahlreiche Kinderstationen, Aktionstage und Extraführungen angeboten.
Sommerausstellung:
66° 30’ Nord – Luftschiffe über der Arktis
Was erlebten Roald Amundsen und Umberto Nobile 1926 auf der ersten Fahrt eines Luftschiffs über den Nordpol? Wieso verunglückte das italienische Luftschiff Italia? Welche Rolle spielte der sowjetische Eisbrecher Krassin bei der Rettung? Was erforschte LZ 127 Graf Zeppelin auf seiner berühmten Arktisfahrt? Welche Bedeutung haben diese Forschungsergebnisse und Erkenntnisse für die heutige Zeit? Antworten auf diese Fragen finden Sie in der Ausstellung. Denn es geht um Abenteuer im „ewigen“ Eis und waghalsige Forscher in ihren Luftschiffen, Flugbooten, Ballonen und Eisbrechern sowie um die Pionierzeit der Klimaforschung und Wetterbeobachtung. Zur Ausstellung werden ein reichhaltiges Begleitprogramm, Familienführungen, ein gleichnamiges Begleitbuch sowie das Kinderbuch „Hugos Arktisfahrt – Ein Eisbär entdeckt den Zeppelin“ angeboten.
bis 20. September 2009
24 Stunden für Wien
Mit einer neuen Wanderausstellung geben die Wiener Stadtwerke Einblicke hinter die Kulissen der Versorgung Wiens mit Infrastruktur auf höchstem Niveau. 24 Stunden für Wien erzählt die Geschichte von Österreichs größtem kommunalem Infrastrukturdienstleister, der Wien seit 60 Jahren mit Mobilität, Licht und Wärme versorgt. Bis Ende August 2009 präsentiert die Wanderausstellung Stadtentwicklungen und
-perspektiven aus der Sicht der Wiener Stadtwerke. Bei freiem Eintritt wird die Ausstellung an drei Orten gezeigt. Sie begann am 9. Juni in der U-Bahn-Station Spittelau, wandert am 16. Juli zum Vorplatz des MuseumsQuartiers Wien und macht Anfang August in der U-Bahn-Station Floridsdorf halt. Im Zentrum der Wanderausstellung stehen historische Entwicklungen, aktuelle Projekte sowie zukünftige Schwerpunkte der einzelnen Konzernbereiche, die für die Besucher(innen) interaktiv erlebbar aufbereitet sind.
Wien wächst. Und damit auch das Leistungsspektrum der Wiener Stadtwerke
Die Wanderausstellung 24 Stunden für Wien erzählt Geschichte und Perspektiven einer modernen Dienstleistungseinrichtung im Kontext der Metropole Wien. Den Rahmen geben die großen Herausforderungen in den Bereichen Mobilität, Energie und Klima- beziehungsweise Umweltschutz vor, denen sich die Stadt in den nächsten Jahren stellen muss. Hauptdarsteller(innen) sind die Wiener Stadtwerke und ihre Konzernbereiche – Wiener Linien, Wien Energie sowie Bestattung Wien –, die eines gemeinsam haben: Sie sind 24 Stunden für alle Wienerinnen und Wiener im Einsatz und sorgen für ein sicheres, leistbares, umweltfreundliches und zuverlässiges Funktionieren der Stadt.
Schwerpunkte der Ausstellung
Die Ausstellung blickt zurück in die Vergangenheit, präsentiert aktuelle Facts & Figures und skizziert die Zukunft Wiens mit einem interaktiven, multimedial aufbereiteten Vermittlungsansatz. Die Besucherinnen und Besucher werden so zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den Themen Verkehr (Wiener Linien), Versorgung (Wien Energie) und Vermächtnis (Bestattung Wien) eingeladen.
• Mithilfe von interaktiven Timelines (Touchscreens) können die Besucherinnen und Besucher Recherchen zu historischen Highlights aus den Bereichen Versorgung, Verkehr und Vermächtnis durchführen.
• Beim interaktiven „Klimahebel“ können die Interessierten in die Rolle einer Stadträtin beziehungsweise eines Stadtrats schlüpfen und so das Klima virtuell positiv beeinflussen.
• Anhand des „Mobilitätsmixers“ erfahren die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher, welche Auswirkung ihre individuelle Fortbewegungsform, also ihr individueller „Mobilitätsmix“, auf die Stadt hat.
• Eine imposante „Ufo-Installation“ lässt schließlich in die Zukunft blicken: Eine 360-Grad-Panoramaperspektive von Wien stellt Zukunftsprojekte von Wien Energie, Wiener Linien und Bestattung Wien vor.
• Die Ausstellung zeigt auch die Bandbreite an Schnittstellen auf, welche die Bürgerinnen und Bürger Wiens mit den Wiener Stadtwerken außerhalb des unmittelbaren „Versorgungszusammenhangs“ verbindet: An den Beispielen Stadtarchitektur und Sponsoring wird die gesellschaftliche Verantwortung der Wiener Stadtwerke und ihrer Konzernbereiche für die Stadt Wien thematisiert.
Informationen
Die Ausstellungstermine:
MuseumsQuartier (Zelt auf dem Museumsplatz):
Do, 16. Juli, bis So, 2. August 2009, 11–22 Uhr
U-Bahn-Station Floridsdorf:
Anfang bis Ende August 2009, 8–20 Uhr
Der Eintritt ist frei!
www.wienerstadtwerke.at
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Unter einem Dach: Alltagskultur von Bürgern, Königen und Päpsten
Nach jüngster Mode gestylt, taucht sie gleich ab – die smarte Badenixe von 1909, eine 50 Zentimeter hohe Skulptur im Keramikmuseum bei Villeroy & Boch. Damit schlägt sie bereits ein großes Thema der internationalen Marke an: Wasser, Bad, Hygiene. 1875 beginnt das Unternehmen mit der Herstellung von Sanitärprodukten und macht das Bad für einen breiten Markt attraktiv und erschwinglich. Dennoch führte dieser Raum bis weit ins 20. Jahrhundert ein Dasein als „Nasszelle“. Erst die legendäre Colani-Kollektion von Villeroy & Boch, 1970 ein Paukenschlag in der Badbranche, eröffnete dem Baddesign eine neue Dimension.
So stehen einander in der Ausstellung Solitäre wie der Doppelwaschtisch Colanis, das Waschschüsselensemble des Märchenkönigs Ludwig und Fliesen der großen Jugendstilmeister Henry van de Velde, Joseph Maria Olbrich und Peter Behrens selbstbewusst gegenüber. Was sie eint, ist die große Traditionsmarke.
Ihr Ursprung liegt im Bereich der Tischkultur. 1748 gründete François Boch in Lothringen eine Töpferei, die seine Söhne mit weiteren Werken auf eine industrielle Basis stellten. Die Kultivierung des Alltags hat für Villeroy & Boch früh begonnen – Jahrhunderte bevor die Begriffe Produkt, Design und Lifestyle geboren wurden. Denn es gelang im 18. und 19. Jahrhundert, durch bahnbrechende Innovationen hochwertiges Geschirr zu moderaten Preisen herzustellen. So spiegeln die Produkte von Anfang an Bedarfslage, Zeitgeschmack und das Selbstverständnis bürgerlicher Schichten quer durch die Epochen.
Illustre Kunden
Doch auch Herrscherhäuser der ganzen Welt schätzen seit Jahrhunderten die Produkte und auch die in den Ateliers hergestellten Sonderanfertigungen des Unternehmens – von den preußischen Königen und russischen Zaren über arabische Scheichs, Jackie Kennedy, Juan Carlos, Lady Di bis hin zum Vatikan. Auch solche Produkte zeigt das Museum in einer erlesenen Auswahl.
Für manchen Gast sind nach diesem erlebnisreichen Kulturparcours Entspannung und Stärkung angesagt. Und die bietet das neue Museumscafé – ein Meisterwerk historistischer Innenarchitektur. Es ist vom Boden bis zur Decke im Stil des berühmten Dresdner Milchladens gestaltet, den Villeroy & Boch im Jahr 1892 entworfen und ausgeführt hatte. In detailgetreuer Handmalerei schufen Keramikkünstler nach den noch erhaltenen Vorlagen teils meterhohe Bilder und Ornamente. Und wer immer noch „Lust auf mehr“ hat, der kann durch den Park der Alten Abtei mit seinen über 200 Jahre alten Bäumen streifen. Hier findet er auch den Alten Turm, das älteste sakrale Architekturdenkmal des Saarlands, und den Schinkel-Brunnen, ein Gastgeschenk des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm an Jean-François Boch aus dem Jahr 1838. Geschichte bei Villeroy & Boch: ein genussvolles Erlebnis inner- und außerhalb der Alten Abtei.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.










 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner 














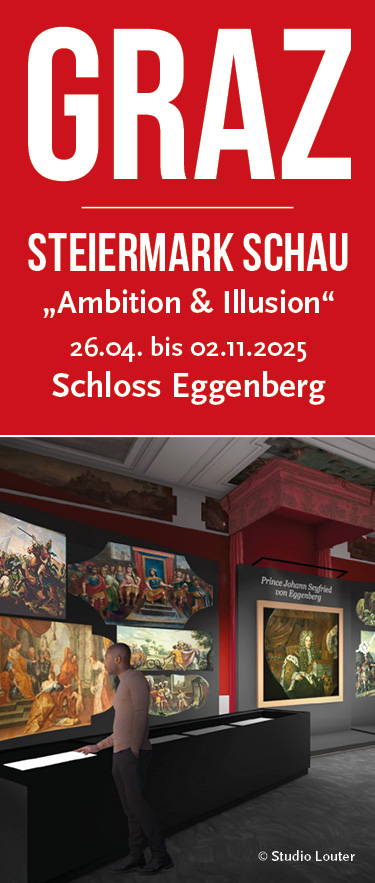







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.