Ausstellung
Tradition und Gegenwart
Bettina van Haaren.
Partikel und Membranen, Malerei, Zeichnungen, Druckgrafik
Afghanistan. Gerettete Schätze. Die Sammlung des Nationalmuseums in Kabul
Die spektakulären Gold-, Silber- und Elfenbeingegenstände sind Zeugen des Königreichs Baktrien, einer Zivilisation, die sich im antiken Afghanistan an den Schnittstellen der Kulturen entlang der Seide
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Mut & Anmut. Frauen in Brandenburg-Preußen
Königin Luise zeigt unter anderem ihre Kleider in Paretz, Lucie von Hardenberg lädt zum Picknick in den Park von Schloss Branitz und Fontanes weibliche Romanfiguren bevölkern die Stadt von Neuruppin.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Wiedereröffnung K20
Die erste Sammlungspräsentation der Direktorin Marion Ackermann auf dem Grabbeplatz folgt einem anderen Rhythmus als zuvor.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Zeitgenössische Kunst und Fotografie
Außergewöhnliche Themenausstellungen zur Kulturgeschichte, oft mit spektakulären archäologischen Funden und neuesten Forschungsergebnissen, bilden mit den Bereichen zeitgenössische Kunst und Fotografi
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Paul Klee – Franz Marc. Dialog in Bildern
Nach dem Tod Franz Marc im Sommer 1916 notierte Paul Klee in sein Tagebuch: „Wenn ich sage, wer Franz Marc ist, muss ich zugleich bekennen, wer ich bin, denn vieles, woran ich teilnehme, gehört auch i
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Mathematik ohne Kopfzerbrechen
Mathematik muss nicht zwingend etwas mit Kopfzerbrechen zu tun haben. Zahlen und Zählen sind im Alltag allgegenwärtig, so allgegenwärtig, dass wir es schon fast nicht mehr bemerken.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Wien Museum Karlsplatz: Die Stadt als „Hauptdarstellerin“
Berühmte Filme, deren Images in die Stadterinnerung einflossen, sind in der Ausstellung ebenso vertreten wie fast unbekannte.
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Das Technische Museum Wien – das Sommererlebnis
Das gegenüber von Schloss Schönbrunn gelegene Technische Museum Wien bietet als einziges umfassendes Technikmuseum Österreichs Informationen und Spaß aus der vielfältigen Welt der Technik: interaktive
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
PLAY ADMONT
Unter Einbeziehung digitaler Technologien wird den Besuchern eine Vielfalt an Betätigungsfeldern und Ausdrucksformen bereitgestellt: Choreografische Objekte, ortsspezifische Hörstationen, situative Ra
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
















































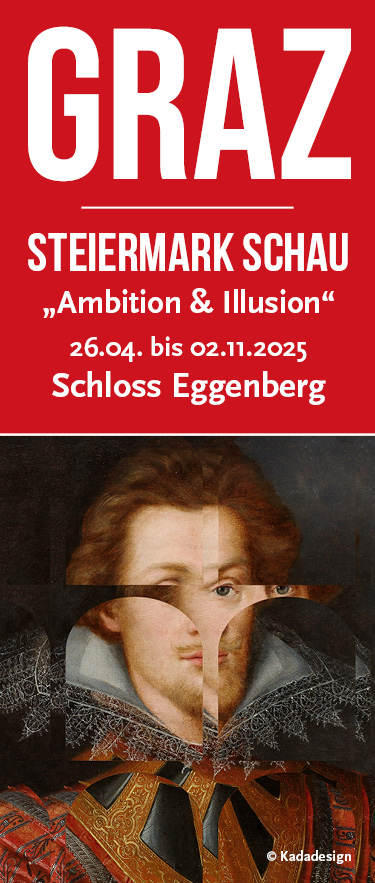







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.