Ausstellung
Zauber und Glanz im Wien Museum
Glanzstücke. Emilie Flöge und der Schmuck der Wiener Werkstätte
Die Wiener Werkstätte war eine 1903 gegründete Produktivgenossenschaft, initiiert von Josef Hoffmann und Koloman Moser. Ihre avantgardistischen Gestaltungsideen zielten auf alle Bereiche des täglichen Lebens ab. Propagiert wurde ein Stil, der dem modernen Leben entsprechen sollte.
Schmuck war die Krönung der Wiener Werkstätte. Die Broschen und Halsketten, die Josef Hoffmann und Kolo Moser ab 1903 entwarfen, waren von radikaler Modernität.
Nicht der materielle Wert stand im Vordergrund, sondern die pure Ästhetik. Der neue Schmuck funkelte nicht mit Diamanten, sondern glänzte mit ornamental eingesetzten bunten Halbedelsteinen, die als ein Ausdruck von Individualität galten. Virtuos wurden geometrische Klarheit und ornamentale Fantasie in Einklang gebracht. Nach englischem Vorbild gab es ein enges Zusammenspiel zwischen Designern mit Kunstanspruch und Handwerkern, welche die Entwürfe virtuos umsetzten.
Präsentiert wurde der neueste Schmuck auch im „Modesalon Flöge“, wo sich eine finanzkräftige Geschmackselite traf. Emilie Flöge war eine trendbewusste Geschäftsfrau, die heute vor allem durch ihre Beziehung mit Gustav Klimt bekannt ist. Sein Porträt von Emilie ist ein Glanzstück der Museumssammlung. Und sie war auch Fotomodell für den WW-Schmuck. Eine besondere Attraktion der Ausstellung sind Ketten und Broschen, die Gustav Klimt seiner Gefährtin schenkte.
Eine Ausstellung in Kooperation mit der Neuen Galerie New York, die erstmals eine Zusammenschau der Schmuckkunst der Wiener Werkstätte bietet, mit Highlights aus amerikanischen und österreichischen Sammlungen.
13. November 2008 bis 22. Februar 2009
Zauber der Ferne. Imaginäre Reisen im 19. Jahrhundert
Das Interesse für fremde Städte, Länder und Kontinente und für exotische Bildwelten wuchs ab 1800 rasant, doch nur wenige konnten sich tatsächlich Reisen leisten. Eine kostengünstige Alternative dazu waren „imaginäre Reisen“. Wichtigstes „Reisebüro“ für diese Ausflüge in die Welt der Träume und Sehnsüchte war der Prater.
Surrogatwelten wie „Venedig in Wien“ lockten Publikumsmassen an, ebenso wie tropische Tierschauen, Buffalo Bills Wildwestshow oder Stammesgruppen aus Schwarzafrika, die vom Publikum begafft und zum Stadtgespräch wurden. Vieles entsprach heutigen Themenparks und virtuellen Freizeitwelten. Mittels Laterna magica – dem Vorgänger späterer Diaprojektoren – konnte das Publikum in ferne Länder, auf fantasievoll gestaltete Mondlandschaften oder in die Tiefen des Meers versetzt werden.
Wie in London und Paris kam es in Wien zu einem Boom von Panoramen und Guckkästen. Doch auch auf der Theaterbühne und in populären Medien spiegelte sich die Sehnsucht nach fernen, exotischen Märchenwelten.
Eine Ausstellung als bunte Revue der Schaulust, mit historischen Apparaten und vom Publikum benutzbaren Rekonstruktionen.
4. Dezember 2008 bis 29. März 2009
Neue Donald Kahn Galleries
Ab nun stehen in der Albertina 2000 Quadratmeter für wechselnde Präsentationen zeitgenössischer Kunst zur Verfügung. Die Albertina hat damit ihre bisherige Ausstellungsfläche auf über 5000 Quadratmeter beinahe verdoppelt.
Für Direktor Dr. Klaus Albrecht Schröder ist damit das Projekt des Umbaus und der Neupositionierung der Albertina vollendet: „Mit dem heutigen Tag ist der im Jahr 2000 begonnene Prozess abgeschlossen, die Albertina, deren Sammlung in der Vergangenheit im Studiensaal nur bruchstückhaft eingesehen werden konnte, in ein Museum umzuwandeln, das seine reichhaltigen Sammlungen in großen Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Mit den Jeanne & Donald Kahn Galleries for Contemporary Art können wir erstmals auch die Großformate unserer 30.000 Werke umfassenden Sammlung an Gegenwartskunst zeigen.“
Die Ausstellungsarchitektur der Kahn Galleries
Die Dramaturgie der Raumfolge entspricht der Architektur eines englischen Landschaftsgartens, mit spannenden Durchblicken, unterschiedlichen Niveaus und mannigfaltigen Point de Vues. Einerseits ist jeder der 16 Räume präzise in sich geschlossen, andererseits ergeben sich durch die überraschenden Blickachsen in die benachbarten Räume fließende Übergänge zwischen den Sälen. Für die Schaffung dieser neuen Galerien zeitgenössischer Kunst wurden in diesem Geschoß Dutzende Zwischenwände ehemaliger Depots, Büros und Wohnungen abgebrochen. 1.400 Tonnen Ziegelmauern wurden entsorgt. Die Kahn Galleries wurden mit 906 Tonnen Stahlbeton erdbebensicher gemacht; 48 Kilometer Kabel wurden verarbeitet. Die Nettobaukosten betragen 5,2 Millionen Euro.
Die Eröffnungsausstellung der neuen Kahn Galleries: Österreichische Kunst nach 1970
Zum Auftakt präsentiert die Albertina in den 16 neuen Räumen der Jeanne & Donald Kahn Galleries die Ausstellung Nach 1970: Österreichische Kunst aus der Albertina. Rund 220 Arbeiten von 34 Künstlern geben einen umfassenden Einblick in die jüngere Kunstgeschichte Österreichs. Neben vielen der bekannten und berühmten Künstler wie Arnulf Rainer, Maria Lassnig, Hermann Nitsch, Max Weiler und Christian Ludwig Attersee, Erwin Wurm und Franz West, Herbert Brandl und Hubert Scheibl, Gottfried Helnwein und Bruno Gironcoli sind viele der spannendsten jüngeren KünstlerInnen hier erstmals zu entdecken. Von Sonja Gangl und Ulrike Lienbacher bis zu Peter Hauenschild und Georg Ritter.
Über 160 Werke stammen aus dem Besitz der Albertina, die insgesamt 30.000 Arbeiten zeitgenössischer Kunst besitzt. 18 Gemälde wurden aus der Kunstsammlung der Österreichischen Nationalbank, mit der die Albertina eine langjährige Partnerschaft verbindet, in diese Ausstellung integriert.
Bis 11. Januar 2009
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641















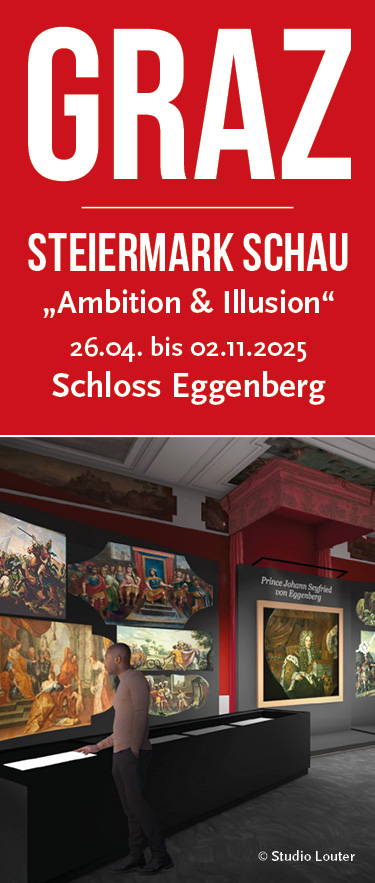







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.