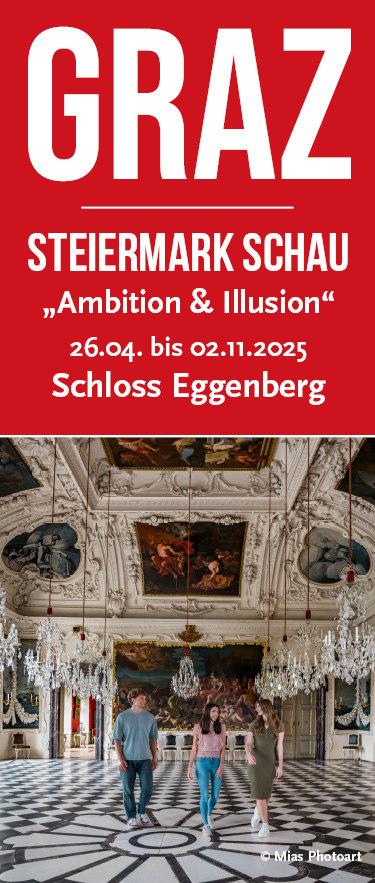Tickets und Infos Theater am Alsergrund Nach Kärnten
SLOWAKISCH IN NEUNZIG MINUTEN
In nur 50 Minuten, schneller als in Italien oder Deutschland, sind Sie in der Slowakei. Wollen Sie sich dort mit Händen und Füßen verständigen? Hoffen Sie, dass alle Slowaken ohnehin deutsch sprechen?
Gut, in 50 Minuten werden Sie nicht slowakisch lernen, aber in 90 Minuten erfahren Sie in diesem Sprachkurz (kurz, slow. = Kurs, dt.) die wichtigsten Grundlagen für diese Sprache. Und das auf humorvolle Weise: Wissen Sie, dass Sie ohnehin schon einen slowakischen Grundwortschatz haben? Kommen Ihnen die Wörter pomali und lepschi bekannt vor? Wissen Sie, dass die slowakische Sprache bis zu 50% ökonomischer ist als Deutsch? Und wissen Sie, wie Sie ganz einfach slowakische Wörter bilden können?
Veranstaltungsvorschau: SLOWAKISCH IN NEUNZIG MINUTEN - Theater Forum Schwechat
Keine aktuellen Termine vorhanden!Wandlungen einer Ehe
Peter, Fabrikant und einsamer Hüter der großbürgerlichen Kultur, ist mit einer schönen und gebildeten Frau verheiratet. Ilonka stammt zwar aus dem Kleinbürgertum, hat den Lebensstil und die Umgangsformen der höherstehenden Schicht aber perfekt verinnerlicht. Doch die Ehe scheitert - trotz oder wegen der unbedingten Liebe, die Ilonka ihrem Mann entgegenbringt. Die Erinnerung an eine dritte Person, das ehemalige Dienstmädchen Judit, steht zwischen dem Paar. Der Schriftsteller Lazar, Peters Jugendfreund, verwandelt als Beobachter die Dreiecksgeschichte in ein strategisches Spielfeld.
Márais Abgesang auf die großbürgerliche mitteleuropäische Welt ist weit mehr ist als eine klassische Dreiecksgeschichte zwischen Mann, Frau und Dienstmädchen. Vor den Kulissen der Budapester Zwischenkriegsperiode - in den großbürgerlichen Salons, eleganten Kaffeehäusern und kargen Dienstbotenzimmern - stellen sich vier unterschiedliche Menschen dieselbe Frage nach der Existenz echter Gefühle und kultureller Verwurzelung. Sylvia Haider hat den erfolgreichen Roman des brillanten Zeitdiagnostikers Sándor Márai für die Bühne adaptiert, und der junge Regisseur Rudolf Frey inszeniert diesen großen Stoff im Kasino am Schwarzenbergplatz.
Veranstaltungsvorschau: Wandlungen einer Ehe - Kasino am Schwarzenbergplatz
Keine aktuellen Termine vorhanden!Spieltriebe 31: Man erschießt ja auch Pferde - Ein Totentanz
Als sie die Zumutungen des erbarmungslosen Tanzmarathons, in den sie voller Hoffnungen gestartet sind, nicht mehr ertragen und zudem erfahren, dass vom verheißenen Hauptgewinn nach Abzug aller Kosten nichts bleiben wird, erlöst Robert die lebensmüde Gloria durch einen Schuss in die Schläfe. Dafür wird er zum Tode verurteilt und hingerichtet.
"Gott möge seiner Seele gnädig sein", lauten die letzten Worte des Urteilsspruches. Mit ihnen endet Horace McCoys Roman "They shoot horses, don't they?", den Sydney Pollack unter gleichem Titel verfilmt hat. Die Theaterfassung des Stoffes spürt dem frommen Wunsch des irdischen Gerichts nach, lässt die Tanzpartner auferstehen und zwingt sie erneut vor ihren Richter. Doch ihr Totentanz dreht sich nicht mehr um juristische Fragen: Wäre ein richtiges Leben im falschen möglich gewesen, lautet das Motto der letzten Runde.
Veranstaltungsvorschau: Spieltriebe 31: Man erschießt ja auch Pferde - Ein Totentanz - Vestibül
Keine aktuellen Termine vorhanden!König Ottokars Glück und Ende
Der grausame Böhmenkönig Ottokar, glücksverwöhnt und unberechenbar, ist tot. Stattdessen ist mit dem bescheidenen Rudolf von Habsburg endlich Frieden in Österreich eingekehrt. Tyrannische Willkür wurde ersetzt durch gottesfürchtige Milde, und somit ist der Weg frei für eine Geschichte, die siebenhundert Jahre andauerte und den Titel trägt: "Die Habsburger in Österreich".
Mit dieser Sichtweise aufs Stück sind seit der Uraufführung von "König Ottokars Glück und Ende" viele Inszenierungen über die Bühne gegangen - Rudolf von Habsburg als Türsteher zum Eingang einer neuen, besseren Zeit. Dabei stellte sich heraus, was für eine großartige Projektionsfläche für die jeweiligen politischen Sichtweisen Grillparzers Stück bot. Eigentlich müsste es demnach "Die Machtübernahme der Habsburger als Entwicklung zum Guten, Gerechten, Geordneten" heißen. Es heißt aber "König Ottokars Glück und Ende" und davon handelt es - vom Glück und Ende eines Menschen und davon, dass das eine manchmal unmittelbar mit dem anderen zusammenhängt.
Veranstaltungsvorschau: König Ottokars Glück und Ende - Burgtheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Das Werk
Das Wasserkraftwerk in Kaprun ist eines der größten Speicherkraftwerke der Welt. Es ist "eine fast beispiellose Herausforderung der Natur an die Technik, die Wasser in drei gigantische Stauseen zu fassen und in die Turbinen zu werfen, damit das 'Land am Strome' (Bundeshymne) mit Strom versorgt werden kann." Das Wasserkraftwerk Kaprun wurde aufgrund der technischen Großleistung der "Männer von Kaprun" zum Symbol des österreichischen Wiederaufbaus.
Veranstaltungsvorschau: Das Werk - Akademietheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Effi Briest
Fontane an Clara Kühnast am 27. Oktober 1895:
"Ja, Effi! Alle Leute sympathisieren mit ihr, und einige gehen so weit, im Gegensatz dazu, den Mann als einen 'alten Ekel' zu bezeichnen. Das amüsiert mich natürlich, gibt mir aber auch zu denken, weil es wieder beweist, wie wenig den Menschen an der sogenannten Moral liegt und wie die liebenswürdigen Naturen dem Menschenherz sympathischer sind."
Veranstaltungsvorschau: Effi Briest - Akademietheater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Triologie des Wiedersehens
Regie: Stefan Bachmann
Bühne: Hugo Gretler
Kostüme: Annabelle Witt
Musik: Felix Huber
Dramaturgie: Susanne Meister
Mit Regina Fritsch, Markus Hering, Roland Koch, Daniel Jesch, Sabine
Haupt, Juergen Maurer, Alexandra Henkel, Melanie Kretschmann, Jörg
Ratjen, Katharina Lorenz, Dietmar König, Johann Adam Oest, Barbara
Petritsch, Philipp Hauß, Michael Masula
Es ist Sommer 1975 und Moritz, Direktor des örtlichen Kunstvereins, hat Mitglieder und Freunde zur Vorbesichtigung seiner Ausstellung „Kapitalistischer Realismus" geladen. Gekommen sind die üblichen Verdächtigen, eine sich selbst reflektierende Gruppe befreundeter Kulturgroupies aus der bürgerlichen Mittelschicht. Mit Kunst ist dieser Gesellschaft nicht mehr beizukommen, die still an den Wänden hängenden Bilder dienen lediglich als Abschussrampen für eigene Vorstellungen von Welt. Der bürgerliche Salon als Ausstellungsraum versinnbildlicht das Theatrale der Situation, die Momentaufnahmen des Textes reihen sich zu einem Menschenzoo, einer geschlossenen Gemeinschaft, die aus ihrem selbstgeschaffenen Spiegelkabinett keinen Ausweg mehr findet.
Trilogie des Wiedersehens - Nähe und Differenz zur lyrischen „Trilogie der Leidenschaft" von Johann Wolfgang von Goethe verweisen ins Zentrum des 1977 uraufgeführten Stückes. Das Wieder-Sehen, ob von Kunst oder Menschen, bleibt folgenlos. Gibtes im dritten Teil bei Goethe die „Aussöhnung", so verharren die Figuren bei Botho Strauß in gemischten Gefühlen. In der Wiederholung des Ewiggleichen sind sie verzweifelt auf der Suche nach einem Gegenüber, getrieben von der unbestimmten Sehnsucht nach der„mythischen Dimension" in ihrem Leben.
Erst als die angekündigte Ausstellung noch vor der Vernissage verboten werden soll, kommt Bewegung in die kunstbeflissene Elite, und das große Aufräumen beginnt ...
Veranstaltungsvorschau: Triologie des Wiedersehens - Burgtheater Wien
Keine aktuellen Termine vorhanden!Warum erst jetzt?
Eine Erzählung über das Schicksal zweier Menschen, die sich im Leben verloren haben. Eine Anatomie der Sehnsucht eines kleinen Jungen nach der väterlichen Liebe. Eine Anatomie der Trinksucht des Vaters. Eine Deflation der Gefühle. Ein heißer Appell an alle Eltern, die sich ohne Rücksicht auf die Kinder scheiden lassen. Eine Rekonstruktion einer authentischen Kindheit aus der Sicht eines Erwachsenen.
Veranstaltungsvorschau: Warum erst jetzt? - Kleines Theater
Keine aktuellen Termine vorhanden!SECOND LIFE - So real, wie du dich fühlst (1. Mose 1.2.)
Ein Bibelverein hat die Bühne okkupiert - für eine Einführungsveranstaltung in das Internetportal »Second Life«. Und hier ist ja bekanntlich alles möglich: Man wählt sich seinen sogenannten Avatar, den Stellvertreter seiner selbst, und begibt sich virtuell in Welten, von denen man vorher noch nicht einmal zu träumen wagte. Hier kriegt Romeo seine Julia, und auf einmal gibt es Arbeit für alle. Der Mensch schafft sich endlich seine (Zweit-)Welt nach eigener Lust und Laune. - Moment! - Hat da nicht schon einmal jemand eine ganze Welt aus freien Stücken erschaffen? Ist das nicht Urzeiten her? Und sogar gleich am Anfang dieses Buches überliefert, das sich Bibel nennt?
Veranstaltungsvorschau: SECOND LIFE - So real, wie du dich fühlst (1. Mose 1.2.) - Kleines Theater
Keine aktuellen Termine vorhanden!Nach Kärnten
Der Traum ist endlich wahr geworden: aus dem südlichsten Bundesland Kärnten wurde ein eigener Staat. Da die Einwohnerzahlen allerdings stetig zurück gehen, wird Radeschnig Birgit durch Restösterreich geschickt, um neue Bewohner für den Staat anzuwerben. Zu diesem Zweck werden unter anderem diverse Bräuche vorgestellt, die mitunter etwas eigenartig sind, und es wird das Geheimnis um das Schild "Nach Kärnten" auf der A2 gelüftet...










 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner