Tickets und Infos Naturhistorisches Museum "Science Goes Public": Lurche und Kriechtiere Wiens
Tapa unter der Lupe - Symbolträchtiger Baststoff aus Ozeanien
Seit Jahren kennen und erleben die Besucher des Bernrieder Museums der Phantasie ein riesiges Stück Stoff, der im eigentlichen Sinne keiner ist, als optisches Bindeglied zwischen der Bilderwelt der expressionistischen Malerei und der von ihren Künstlern vielgeliebten und als inspirierend empfundenen Welt der „Urformen“ afrikanischer und ozeanischer Holzbildhauerkunst.
Der etwa ein halbes Jahrhundert alte Rindenbaststoff tapa ngatu der Sammlung Buchheim ist aufwändig aus Einzelteilen aneinandergefügt und zudem feinsinnig bemalt. Symbole wie die Königskrone sind dem europäischen Betrachter aus der eigenen Tradition bekannt. Bedeuten sie aber dasselbe wie in unserer Überlieferung? Wie steht es mit dem Sinnbildgehalt der anderen zum Teil aufgestempelten, zum Teil mit Naturfarben aufgemalten Motive? Ist dieser tapa gar als Bilderhandschrift einer Südseekultur zu verstehen und zu lesen?
Der Unterschied zwischen tongaischem tapa und hawaiianischem kapa etwa besteht nicht nur aus einem Buchstaben, sondern in grundverschiedenen Farbgebungen und Musterungen. Erstaunlich ist die Bandbreite dieser Rindenbaststoffe, die zwar mit einfachen natürlichen Grundmaterialien, jedoch mit ausgefeiltesten Techniken hergestellt wurden.
In der im Buchheim Museum installierten Dokumentations-Ausstellung "Tapa unter der Lupe – Symbolträchtiger Baststoff aus Ozeanien" werden die Rätsel um den Buchheim'schen Tapa gelöst. Außerdem führt eine bildbetonte Kurzdokumentation zu anderen ozeanischen Produktionsstätten der bunten Stoffe und gibt einen kleinen Überblick über Mustervielfalt und feinsinnige Handwerkskunst der Südsee.
Soviel ist sicher: Wer sich hier etwas Zeit zum Schauen nimmt, verwechselt in Zukunft nie mehr tapa mit kapa…
Veranstaltungsvorschau: Tapa unter der Lupe - Symbolträchtiger Baststoff aus Ozeanien - Buchheim Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!Die Unruhe wächst
Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird 20 Jahre nach Hoehmes Tod und 50 Jahre nach dem Durchbruch der Abstraktion als „Weltsprache“ auf der documenta II sein Werk erstmals so umfassend präsentiert: Das museum kunst palast präsentiert Arbeiten auf Papier aus der Gerhard und Margarete Hoehme-Stiftung, ergänzt um Zeichnungen und Druckgraphik aus der eigenen Sammlung. Das MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst (Duisburg) gibt in einer großen, retrospektiv angelegten Werkschau Einblick in die wesentlichen Schaffensprozesse des Künstlers der Jahre 1955-1989. und die Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum (Duisburg) zeigt bildplastische Werke aus eigenem Besitz.
Der Künstler
Gerhard Hoehme hat in seinem eigenwilligen, vielschichtigen Werk die Grenzen des Bildes und des Bild-Raums stets aufs Neue insistierend befragt und erweitert. Mit seinen bildnerischen und plastischen Arbeiten, den Zeichnungen und Rauminstallationen leistete er einen entscheidenden Beitrag zur internationalen Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die Ausstellung im museum kunst palast
Das museum kunst palast – Sitz der Gerhard und Margarete Hoehme-Stiftung – präsentiert im Rahmen der gemeinsamen Ausstellungsinitiative ein umfangreiches Konvolut von Hoehme-Papierarbeiten aus den Beständen der Stiftung. Sie werden um Zeichnungen und Druckgrafik aus der eigenen Sammlung ergänzt. Hier wird ein zeichnerischer Kosmos (wieder-)entdeckt, der – vergleichbar den Zeichnungen von Hoehmes Akademiekollegen Joseph Beuys – ungewöhnlich eindringliche Sensibilität aufweist. Hoehmes Arbeiten aus den 1950er-1980er Jahren veranschaulichen, wie der Künstler – einer der Wegbereiter des deutschen Informel – informelle Bildkonzepte weiterentwickelte, sich daraus löste und ganz eigene, auch im Hinblick auf z.T. verwendete „kunstfremde“ Materialien, experimentelle Wege beschritt.
Veranstaltungsvorschau: Die Unruhe wächst - Museum Kunstpalast
Keine aktuellen Termine vorhanden!Per Kirkeby
Nach seinem Geologiestudium und mehreren Expeditionen nach Grönland hat Kirkeby seit Mitte der 1960er Jahre konsequent einen künstlerischen Weg beschritten, der neben der Erforschung der vielfältigen Möglichkeiten der Malerei auch die Arbeit als Bildhauer, Architekt, Drucker, Zeichner, Filmemacher und Schriftsteller umfasst.
Die Ausstellung
Die in Zusammenarbeit mit der Tate Modern, London, erarbeitete und für das museum kunst palast erweiterte Ausstellung PER KIRKEBY bietet mit etwa 250 Werken - Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen, Büchern und Filmen - einen Überblick über das Gesamtwerk des Universalkünstlers. Als Erweiterung zu der Düsseldorfer Ausstellung können die auf der Insel Hombroich nahe Düsseldorf von Per Kirkeby errichteten Gebäude aus Backsteinen gesehen werden, die als begehbare Skulpturen beispielhaft für seine Arbeit an der Schnittstelle von Bildhauerei und Architektur stehen.
Kuratiert wird die Ausstellung von museum kunst palast: Beat Wismer, Generaldirektor und Kay Heymer, Leiter der Moderne;
Tate Modern, London: Achim Borchardt-Hume und Cliff Lauson
Veranstaltungsvorschau: Per Kirkeby - Museum Kunstpalast
Keine aktuellen Termine vorhanden!Caspar Wolf: Gipfelstürmer zwischen Aufklärung und Romantik
Caspar Wolf und die Gebirgsmalerei
Veranstaltungsvorschau: Caspar Wolf: Gipfelstürmer zwischen Aufklärung und Romantik - Museum Kunstpalast
Keine aktuellen Termine vorhanden!Johannes Brus: Giving picture for trophy
Brus schafft monumentale Tableaus mit einer geradezu körperlichen Ausstrahlung, indem er die schwarz-weißen Fotovorlagen mit chemischen Verfahren verfremdet.
Der Ausstellungstitel bedeutet sowohl Geben eines Motivs als auch Ein Bild als Trophäe erstellen und Ein Bild als Trophäe ausstellen. Brus bearbeitet oft vorgefundene alte Fotos, darunter von Europäern aufgenommene Gruppenporträts indischer Maharadschas, aber auch Bilder klassischer Jagdtrophäen.
Diese Auseinandersetzungen mit dem Fremden, Wilden und Exotischen unterlaufen eine Domestizierung und hinterfragen zugleich Bedingungen und Möglichkeiten der künstlerischen Produktion und der Rezeption. Trophäen sind Zeichen des Sieges, die, als Prestigeobjekte mit neuer Bedeutung aufgeladen, zur Schau gestellt werden. Brus’ Arbeiten konfrontieren den Betrachter mit vertrauten Trophäen aufs Neue, diese erwachen zum Leben, entziehen sich und ergreifen Besitz von der Imagination des Betrachters.
Veranstaltungsvorschau: Johannes Brus: Giving picture for trophy - Museum Kunstpalast
Keine aktuellen Termine vorhanden!Eine Krone für die Stadt. Walter Gropius im Wettbewerb
Im Jahr 1927 schrieb die Stadt Halle einen bemerkenswerten Architekturwettbewerb aus: Auf dem Lehmanns-Felsen sollte als neues, signifikantes Zentrum der Stadt eine monumentale Stadtkrone mit Stadthalle, Konzerthalle, Museum und Sportanlagen entstehen. Die Idee ging zurück auf Bruno Taut, der entsprechende sozialutopische Visionen nach 1919, als sich eine Gruppe fortschrittlich gesinnter Architekten im „Arbeitsrat für Kunst“ zusammenschloss, entwickelte. Im Zentrum der Stadt wünschte er sich einen gläsernen Tempel der Gemeinschaft als neuen Mittelpunkt einer freien Gesellschaft. Im „roten Halle“ fanden diese Ideen früh ihren Widerhall. Mit dem Wettbewerb im Jahr 1927, den die Presse als „Akropolis von Halle“ betitelte, sollte diese Utopie gebaute Wirklichkeit werden.
An dem Wettbewerb beteiligten sich die bedeutendsten deutschen Architekten der Klassischen Moderne: Walter Gropius, Hans Poelzig, Peter Behrens, Emil Fahrenkamp, Paul Bonatz und Wilhelm Kreis. Auch reichten zahlreiche lokale Architekten und Künstler, darunter Paul Thiersch und Karl Völker, Entwürfe ein. Realisiert wurde keiner der Vorschläge und der Wettbewerb geriet über die Jahrzehnte vollständig in Vergessenheit. Es haben sich jedoch von den meisten Teilnehmern zahlreiche Originalpläne erhalten. Allein von Walter Gropius existieren noch 15 Entwürfe, von Peter Behrens wurden kürzlich sechs Originalentwürfe aufgefunden, die bislang als verloren galten, von Hans Poelzig sind 10 Originalzeichnungen vorhanden. Insgesamt werden in der Ausstellung 44 Originale und 8 Reprints sowie Architekturmodelle der wichtigsten Wettbewerbseingänge gezeigt, Arbeiten von Studierenden der BTU Cottbus für diese Ausstellung.
Sie wird begleitet von einem Katalog mit mehreren wissenschaftlichen Beiträgen. Im Rahmen der Ausstellung sollen diese einmaligen Architekturzeichnungen erstmals öffentlich präsentiert und analysiert werden. Im Mittelpunkt wird dabei der Entwurf „Hängende Gärten“ von Walter Gropius stehen, sowie die Planungen von Peter Behrens und Hans Poelzig. Im Kontext der anderen eingereichten Wettbewerbsbeiträge kann mit diesem Material ein weitgehend neuer Blick auf die hallesche Kultur- und Architekturpolitik geworfen werden.
Veranstaltungsvorschau: Eine Krone für die Stadt. Walter Gropius im Wettbewerb - Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Gerald Scarfe: "Tear down the Wall" - Werke für "Pink Floyd", Politische Karikaturen und satirische Porträts
Weltbekannt wurde Scarfes Arbeit vor allem durch seine Tätigkeit als Art Director für Pink Floyd auf dem epochalen Konzeptalbum „The Wall“ von 1978 -1979, dem daraus folgenden Film mit zahlreichen Animationssequenzen und den dazugehörigen Konzerten, für die er auch die Bühneneinrichtung entwarf.
Erstmals werden seine Zeichnungen und Animationen für das Konzert und den Film „The Wall" von Pink Floyd, die zwischen 1978 und 1991 entstanden sind, in Deutschland in einer eigenen Ausstellung gewürdigt.
Veranstaltungsvorschau: Gerald Scarfe: "Tear down the Wall" - Werke für "Pink Floyd", Politische Karikaturen und satirische Porträts - Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Denkmale für die Arbeit. Wirtschaftsgeschichte im Spiegel der Medaillenkunst
Die Form der Medaille spiegelt als handliches Erinnerungszeichen – vom anspruchsvollen Kunstwerk bis hin zum einfach gestalteten Souvenir – die wirtschaftliche Entwicklung und unternehmerisches Handeln vor allem im 19. und 20. Jahrhundert in besonderer Weise.
Die Medaillen verewigen die Entwicklung von Unternehmen, den Wandel des Bildes (des) vom Arbeiter(s) sowie vom (des) Unternehmer(s), ihrer Erfolge und Verdienste. Die Medaille ist damit eine künstlerische und wirtschaftshistorische Quelle. In einer Auswahl aus der Sammlung des Landesmünzkabinetts Sachsen-Anhalt präsentiert die Stiftung Moritzburg von … bis … signifikante Denkmale der Arbeitswelt aus unterschiedlichen Branchen. Zeugnisse der mitteldeutschen und halleschen Wirtschaftsgeschichte stehen im Mittelpunkt. Dazu gehören Preismedaillen von der halleschen Maschinenbaufirma F. Zimmermann, die erstmalig öffentlich gezeigt werden. Sie wurden auf den verschiedensten Messen in Europa errungenen und von der Tochter des Firmengründers bereits im Jahr 1894 dem Museum gestiftet.
Veranstaltungsvorschau: Denkmale für die Arbeit. Wirtschaftsgeschichte im Spiegel der Medaillenkunst - Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public": Verstaubt, Verschroben, oder doch von dieser Welt?
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Mag. Dominique Zimmermann.
Veranstaltungsvorschau: "Science Goes Public": Verstaubt, Verschroben, oder doch von dieser Welt? - Naturhistorisches Museum
Keine aktuellen Termine vorhanden!"Science Goes Public": Lurche und Kriechtiere Wiens
Was vielen BesucherInnen des Naturhistorischen Museums verborgen bleibt, ist die Arbeit in den wissenschaftlichen Abteilungen, die allen gezeigten Ausstellungen und auch der permanenten Schausammlung zugrunde liegt. Sehen Sie das Naturhistorische doch mal mit den Augen eines Forschers und erfahren Sie Interessantes aus der Welt der Wissenschaft - bei "Science Goes Public" - Einblicke in die Welt der Wissenschaft! Mit Dr. Heinz Grillitsch.

















 AnachB Routenplaner
AnachB Routenplaner 

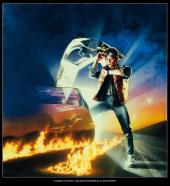
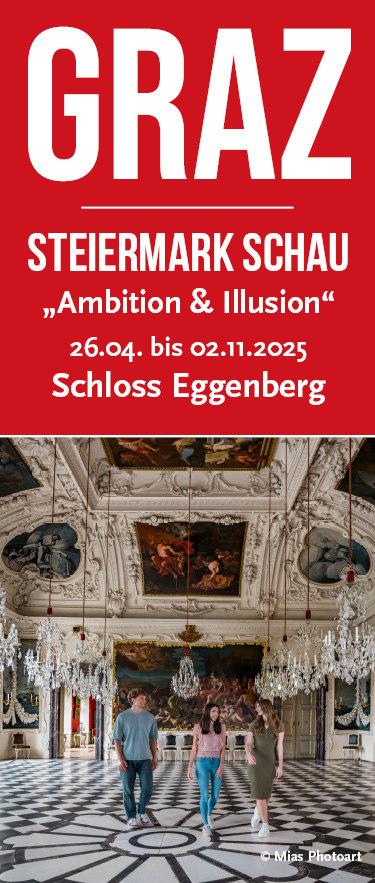







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.