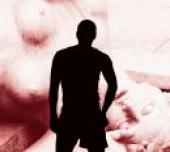Reigen
Fünf Männer und fünf Frauen treffen hier nur aus einem Grund zusammen: sie wollen Sex. In zehn Dialogen begegnen sich dazu paarweise die Geschlechter – namenlos und nur als Typen personalisiert: Ob Soldat oder Stubenmädchen, Schauspielerin oder Graf, allen geht es um das Eine. Doch das Eine zeigt Schnitzler nur im Gedankenstrich und lenkt damit den Blick vielmehr auf das Davor und das Danach. Denn je nachdem, wer hier auf wen trifft, fallen diese Begegnungen doch sehr unterschiedlich aus. Während Dirne und Soldat die Angelegenheit am Donauufer sehr zügig erledigen, wird beim Ehebruch im Salon erst einmal Stendhal zitiert, bevor es zur Sache geht. Und hat sich eine Figur vom gerade noch begehrten Gegenüber verabschiedet, beginnt sie in der darauf folgenden Szene das Spiel von neuem. Mit einem anderen Partner versteht sich… Dieser Querschnitt durch die Wiener Schlafzimmer der Jahrhundertwende entblößt vor allem eines: eine Doppelmoral, bei der tatsächliches Handeln und öffentliche Vorstellung im absoluten Widerspruch zueinander stehen. Schnitzler traf damit einen wunden Punkt - und verursachte einen Theaterskandal. Aufhänger war die vermeintliche Pornographie des Stücks, in Berlin wurden Regisseur und Darsteller sogar wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ angeklagt. Doch der eigentliche Tabubruch lag nicht in der – ohnehin ausgesparten –Darstellung des Geschlechtsakts: Tabu war der nackte Blick auf die leere Hülle des gesellschaftlichen Zusammenlebens.