Tickets und Infos Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt Adolf Senff. Blütenreigen und Farbenpracht
Zerrissene Helden und Figuren voller Wunden
Berühmt wurde er durch seine Umkehrung des Bildmotivs, indem er Figur, Porträt oder Stillleben einfach auf den Kopf stellte. Georg Baselitz gehört mittlerweile zu den berühmtesten und gefragtesten Künstlern, seine Werke füllen die wichtigsten Museen der Welt, seinetwegen erhielt die deutsche Malerei einen Stellenwert wie niemals zuvor.
Das Jahresende im Museum Frieder Burda und der benachbarten Staatlichen Kunsthalle steht ganz im Zeichen dieses bedeutenden Malers und Bildhauers.
Die Ausstellung Baselitz. Eine Retrospektive vom 21. November bis 14. März 2010 zeigt im Museum Frieder Burda 50 Jahre Malerei und in der Staatlichen Kunsthalle 30 Jahre Skulptur von Georg Baselitz. Insgesamt umfasst die Ausstellung rund 140 Kunstwerke. Kuratiert wird die Ausstellung von Georg Baselitz selbst sowie von Götz Adriani (Museum Frieder Burda) und Karola Kraus (Staatliche Kunsthalle Baden-Baden).
Mit 50 Jahre Malerei knüpft das Museum Frieder Burda an eine Ausstellungsreihe mit Werken von Sigmar Polke (2007) und Gerhard Richter (2008) an, die jeweils aus renommierten Privatsammlungen zusammengestellt wurden.
Die Werkschau 50 Jahre Malerei präsentiert erneut überwiegend Leihgaben aus bedeutenden Privatsammlungen wie Josef Froehlich, Sylvia und Ulrich Ströher, Friedrich Christian Flick, Uli Knecht oder Frieder Burda. Die Ausstellung zeigt rund 80 Gemälde und 40 Arbeiten auf Papier von Georg Baselitz von den Anfängen bis heute. Sie ermöglicht eine fundierte Einsicht in die Vorgehensweisen des Künstlers.
In 50 Jahren hat Georg Baselitz ein umfangreiches und inhaltlich abwechslungsreiches Werk hervorgebracht, in dem er neue Wege beschreitet und künstlerische Maßstäbe setzt. In seinen Heldenbildern Mitte der 1960er-Jahre illustriert er im Stil der monumentalen Figurenmalerei irritierend wirkende Gestalten, die einen inneren Kampf ausfechten. Neun Beispiele dieser berühmten Reihe werden im Museum Frieder Burda zu sehen sein.
Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zeigt mit 30 Jahre Skulptur das bildhauerische Werk des Künstlers von der ersten Arbeit, Modell für eine Skulptur (1979), bis zu der neuesten Skulptur, Folk Ding Zero, die in Baden-Baden erstmals vorgestellt wird. In jedem der neun Oberlichtsäle werden Skulpturen aus neun wichtigen Schaffensphasen von Baselitz gezeigt. Punktuell werden diese zusammen mit Bildern präsentiert, die das gleiche Sujet wie die Skulpturen bearbeiten. Denn in vergleichbarer Weise, wie der Maler Baselitz in seinen Gemälden dem Malakt und damit konsequenterweise den einzelnen Pinselzügen eine größtmögliche Freiheit einräumt, so behandelt der Bildhauer Baselitz das Holz mit Kettensäge, Beil und Stecheisen. Auch in der Skulptur, der sich Baselitz erstmals 1979 widmet, strebt er gegen Harmonie und Symmetrie. Die lebhafte Sprachkraft der bildnerischen Mittel ist, so der Künstler, im Medium Skulptur viel direkter lesbar und weniger verschlüsselt als in der Malerei.
Dabei geht es Baselitz, der sich in seinen frühen Skulpturen zunächst mit dem Sujet der Figur auseinandersetzt, nicht um eine konkrete Person, sondern um das Abbild als Träger seiner künstlerischen Ideen. Mit Aggression bearbeitet Baselitz Ahorn, Lindenholz, Rotbuche oder Zedernholz. Die entgegen aller handwerklich-künstlerischen Eleganz gesägten, geschnitzten und gestochenen Skulpturen wirken oft wie „Figuren voller Wunden“.
Erfolgreich unterstützt wird das Haus seit vielen Jahren von der WWS Strube GmbH, die mit ihrem Fullservice für einen perfekten Ablauf aller Dienstleistungen garantiert.
Informationen
Baselitz. Eine Retrospektive
21. November 2009 bis 14. März 2010
Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8b, D-76530 Baden-Baden
Tel. (+49-72 21) 39 8 98-0
Di–So 10–18 Uhr, Mo geschlossen
www.museum-frieder-burda.de
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a, D-76530 Baden-Baden
Tel. (+49-72 21) 30 0 76-3
Di–So 10–18 Uhr, Mo geschlossen
www.kunsthalle-baden-baden.de
Manieren. Geschichten von Anstand und Sitte aus sieben Jahrhunderten
700 Jahre gutes und schlechtes Benehmen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung Manieren, die ausschließlich im Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte zu sehen ist. Über 200 hochwertige Exponate erzählen auf 800 Quadratmetern Geschichten von den Ursprüngen und Erscheinungsformen gesellschaftlicher Regeln und Tabus, vom Streben nach gefälliger Selbstdarstellung, von Rücksichtnahme und Distanzverlust, von Feinsinn und Rüpelei, von Peinlichkeitsschwellen und deren lustvoller Überschreitung, aber auch von Mechanismen gesellschaftlicher Ausgrenzung. Dabei macht das Zusammenspiel von historischen Exponaten und vertrauten Gegenständen aus dem Alltag den besonderen Reiz der Ausstellung aus. Feines Rokokoporzellan neben Loriot-Sketchen, historische Gemälde gegenüber aktuellen Fotoserien – die Reise durch die Vergangenheit führt immer wieder in die Gegenwart zurück.
In 13 Kapiteln folgt die Ausstellung der Kulturgeschichte unserer Umgangsformen durch die Jahrhunderte. Den Auftakt bildet eine „Benimm-Bibliothek“. Rund um das Porträt des Aufklärers Adolph Freiherr Knigge stimmen Zitate aus 800 Jahren europäischer Etiketteliteratur auf das Thema ein. Neben Knigges Werk Vom Umgang mit Menschen aus dem Jahr 1788 zeugen Erstausgaben der wichtigsten Anstandsbücher seit dem Mittelalter von der langen Tradition der Gattung. In den anschließenden Bereichen wird ein Bogen von der Tischkultur über Themen wie Hygiene und Scham, das Verhalten im öffentlichen Raum, die Kultivierung schlechter Manieren, Galanterie, Haltung und Kommunikation bis hin zu Hierarchien und Abhängigkeiten gespannt. In einem kleinen Kino werden Filmausschnitte zum Thema Benimmunterricht gezeigt. Ob Loriot oder Pippi Langstrumpf, hier findet sich allerhand Unterhaltsames. Am Ende des Gangs durch die „anständige Kulturgeschichte“ fordert der letzte Ausstellungsbereich zur Würde des Menschen den Besucher auf, selbst Stellung zu beziehen. Hier schließt sich der Kreis, der mit Knigge begann. Obwohl Knigges Name heute viele Benimmratgeber ziert, ging es dem vermeintlichen Verkünder goldener Lebensregeln nicht um Tischsitten oder Stilfragen, sondern um einen anständigen Umgang der Menschen miteinander. Dabei bezog er erstmals alle gesellschaftlichen Schichten in seine Betrachtungen ein. So möchte auch die Ausstellung im Focke-Museum keine Benimmregeln vermitteln, sondern zum Nachdenken über Rücksicht und Toleranz als innere Notwendigkeit anregen.
Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Prinz Asfa-Wossen Asserate, Autor des 2003 erschienenen Bestsellers Manieren. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird die Ausstellung begleiten.
Informationen
29. November 2009 bis 30. Mai 2010
Katalog Manieren. Geschichten von Anstand und Sitte aus sieben Jahrhunderten, Edition Braus, 2009. 208 Seiten mit farbigen Abbildungen aller gezeigten Objekte, 28 Euro
Focke-Museum | Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
Schwachhauser Heerstraße 240, D-28213 Bremen
Tel. (+49-421) 69 96 00-0
Di 10–21 Uhr, Mi–So 10–17 Uhr,
Fei: Sonderregelung
Öffentliche Führungen: Sa 15 Uhr,
So und Fei 11.30 und 15 Uhr
[email protected]
www.focke-museum.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Zukunft seit 1560
Aus diesem Anlass blicken sie zurück auf die lange Geschichte der Sammlungen, erinnern an Herrscher, Gründer, Sammler, Wissenschaftler und Förderer, und dabei wird deutlich, dass von Anfang an der Blick in die Zukunft charakteristisch gewesen ist: Schon immer prägten Visionen der verbesserten Präsentation, des optimalen Bewahrens und Erhaltens und der intensiveren Forschung das Gesicht der Museen, die heute als Staatliche Kunstsammlungen Dresden international bekannt sind und Gäste aus aller Welt nach Sachsen ziehen. Die lang erwartete Wiedereröffnung des Albertinums, die Neupräsentation der Türckischen Cammer sowie zahlreiche große Ausstellungen im Jubiläumsjahr legen Zeugnis davon ab, dass alles in Bewegung bleibt.
Eröffnung der Türckischen Cammer
Nach nunmehr 70 Jahren ist es ab Februar 2010 wieder möglich, die Schätze der Türckischen Cammer – einer der weltweit prächtigsten und bedeutsamsten Sammlungen orientalischer Kunst – in einer einmaligen Neupräsentation im Dresdner Residenzschloss zu erleben. Funkelnde Edelsteine und Gold in glänzendem Licht und geheimnisvoll abgedunkelten Bereichen lassen die Besucher in eine fantastische Welt eintauchen. Zirka 600 prachtvolle orientalische und orientalisierende Objekte trugen die sächsischen Herrscher durch diplomatische Geschenke, Ankäufe und Beutestücke unterschiedlicher Schlachten gegen die Osmanen über mehrere Jahrhunderte zusammen. Präsentiert werden die Kostbarkeiten in nachtblauen Räumen, die den Besucher in eine fantastische Welt entführen.
Februar 2010, Dresdner Residenzschloss
Zukunft seit 1560
Die Ausstellung
Vor 450 Jahren gründete Kurfürst August im Dresdner Schloss eine der ersten Kunst- und Wunderkammern des Heiligen Römischen Reichs. Auf ihre Bestände gehen die Dresdner Kunstsammlungen zurück, die bis heute eine der bedeutendsten, differenziertesten und ältesten Sammlungen in Europa sind. Die Ausstellung zeigt die faszinierenden Anfänge mit einem breiten Spektrum an Objekten von Naturalien über Gemälde und Druckgrafiken bis hin zu kostbaren Preziosen. Von dieser Kunstkammer im Jahr 1560 ausgehend, beleuchtet die Schau die Geschichte und Entwicklung der Dresdner Sammlungen im Verlauf der Geschichte bis heute und spricht dabei auch die grundsätzlichen Aspekte der Museumsgeschichte, des Sammelns, Bewahrens und Präsentierens an.
18. April bis 7. November 2010, Residenzschloss
Triumph der blauen Schwerter
Meißner Porzellan für Adel und Bürgertum 1710 bis 1815
1710 gründete August der Starke in Meißen die erste Porzellanmanufaktur auf europäischem Boden und begründete so den „Mythos Meißen“. Die kostbaren Erzeugnisse avancierten schnell zu einem unverzichtbaren Statussymbol der europäischen Fürstenhäuser und gelten bis heute auf der ganzen Welt als Inbegriff eleganter Tischkultur. Die Porzellansammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden nimmt das 300-Jahre-Jubiläum dieser Gründung zum Anlass für eine Ausstellung, die sich auf die für die Manufaktur so ereignisreichen ersten 100 Jahre konzentriert. Zwischen 1710 und 1815 entwickelte Meißen das ganze Spektrum der Möglichkeiten, die dem europäischen Porzellan fortan zur Verfügung stehen sollten: Es verkörperte die europäische Porzellankunst schlechthin. Nach fast 300 Jahren ist in der Ausstellung erstmals wieder Meißner Porzellan in dem Schloss zu sehen, das August der Starke einst ausschließlich der Präsentation der königlichen Porzellanschätze gewidmet hatte: im Japanischen Palais.
8. Mai bis 29. August 2010, Japanisches Palais Dresden
Zauber der Zerbrechlichkeit. Meisterwerke europäischer Porzellankunst
Die Ausstellung Zauber der Zerbrechlichkeit im Ephraim-Palais in Berlin möchte einerseits die Strahlkraft, die vom Meißner Porzellan ausging, beleuchten, andererseits soll auch der Aspekt der gegenseitigen Einflussnahme in den Blickpunkt gestellt werden. Die rund 50 bedeutendsten europäischen Porzellanmanufakturen werden in dieser Ausstellung zusammentreten, um Meißen anlässlich des 300-Jahre-Jubiläums die Ehre zu erweisen. Etwa 500 Exponate aus zahlreichen internationalen Museen und Sammlungen zeichnen in dieser einmaligen, erstmaligen Zusammenstellung der hochkarätigsten Porzellanmanufakturen ein lebhaftes Bild europäischen Porzellans im 18. Jahrhundert. Sie vermitteln gut nachvollziehbar die ästhetischen Qualitäten, die Unterschiede und jeweiligen Besonderheiten.
9. Mai bis 29. August 2010, Ephraim-Palais Berlin
Wiedereröffnung des Albertinums als Museum des 19. Jahrhunderts
und der Moderne
Wenn im Juni 2010 das Albertinum wiedereröffnet wird, dann wird die Kunst der Moderne in einem Umfang erlebbar sein, wie es zuvor in Dresden nicht möglich war. Neben dem neuen, hochwassersicheren Werkstatt- und Depotkomplex – einer architektonischen Meisterleistung – wird auch die innovative Museumskonzeption für einen neuen Anfang in der Kunstpräsentation in Dresden stehen. Die Kunst der Moderne – ab dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart – wird dann in neuem Ausmaß, neuer Zusammenstellung und in all ihren Gattungen gezeigt.
Endlich wieder werden die bedeutenden Bestände der Romantiker im Albertinum präsentiert. Das Augenmerk liegt zudem vor allem auf der moderner Kunst in Dresden und Künstlern aus der Region: Für Gerhard Richter, Georg Baselitz und A. R. Penck wird es gesonderte Ausstellungsräume geben.
Juni 2010
Jeff Wall. Transit
Parallel zur Eröffnung des Albertinums zeigen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in der Kunsthalle im Lipsiusbau eine große Ausstellung mit Werken des kanadischen Fotografen Jeff Wall. Die unter dem Motto „Transit“ zusammengestellten Bilder behandeln das Thema des Übergangs und der Veränderung im Kontext historischer, soziologischer und alltäglicher Erfahrungen. Der Lipsiusbau an der Brühlschen Terrasse in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hochschule der bildenden Künste wird gemeinsam mit dem wiederöffneten Albertinum weiterhin den bedeutendsten Anlaufpunkt für zeitgenössische Kunst in Dresden bilden.
Juni 2010, Kunsthalle im Lipsiusbau
Weitere Ausstellungen
im Jubiläumsjahr
Sammlung Schmidt-Drenhaus II
20. Februar bis 16. Mai 2010,
Kunsthalle im Lipsiusbau
Der frühe Vermeer
3. September bis 28. November 2010,
Zwinger, Semperbau
Kunsthallen-Ausstellungsprojekt
Beyond Borders
Ende Oktober 2010 bis Januar 2011,
Kunsthalle im Lipsiusbau
Fragmente der Erinnerung. Der Tempel Salomonis im Dresdner Zwinger. Facetten und Spiegelungen eines barocken Architekturmodells
Juli 2010, Zwinger, Wallpavillon
Die Kunst der Aufklärung
September 2010 bis Februar/März 2012
Ausstellung der Staatlichen Museen zu Berlin, der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, München im National Museum of China in Peking.
Informationen
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Tel. (+49-351) 4914 2000
[email protected]
www.skd.museum
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
47 Meter hohe Doppelhelix – Bauen am Limit
Die Architektur ist genauso spektakulär wie die einzigartigen Exponate. Denn für das Gebäude hatten sich die Architekten von UN Studio van Berkel & Bos und Sobek Ingenieure die Form einer Doppelhelix ausgedacht: Im gesamten Gebäude sind kaum rechte Winkel zu finden, die Wände sind fast alle geneigt, ebenso wie ein Großteil der Wege, welche die Besucher auf ihrer Zeitreise in die Automobilgeschichte durch das Museum führen.
Im Spannungsfeld von Terminen, Kosten und Qualität
Zweieinhalb Jahre bevor Motor-Velociped, Parsifal, Silberpfeil und mehr als 160 weitere Fahrzeugexponate in das Museum einrollen konnten, standen die Bauherren der Daimler AG vor außergewöhnlichen Herausforderungen: Wie lässt sich auf dem 57000 Quadratmeter großen Baugelände innerhalb von zweieinhalb Jahren Bau- und Einrichtungszeit – denn pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft im Sommer 2006 in Deutschland sollte eröffnet werden – eine Immobilie mit derart komplexer Architektur auf die Beine stellen? Die Lösung war mit einer Projektmanagementbeauftragung von Drees & Sommer schnell gefunden – bereits vorher verband die Unternehmen eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit, beispielsweise beim Potsdamer Platz in Berlin. Außerdem stellte das Unternehmen bereits bei unterschiedlichen Museums-, Kunst- und Kulturbauten sein Können unter Beweis. Das Kunstmuseum in Stuttgart, das Literaturmuseum der Moderne in Marbach, die Anna Amalia Bibliothek in Weimar und die Arena Ludwigsburg sind Teil der endlosen Referenzliste.
Heute das Gestern mit dem Morgen verbinden
Auch beim interessantesten Design sollten die Betreiberkosten, basierend auf dem Businessplan der Museums GmbH, und die darin enthaltenen Betriebskosten nicht vergessen werden. Die Facility-Management-Berater von Drees & Sommer berücksichtigten dies bereits während der Planung und trugen damit zu einer langfristig ökonomischen Bewirtschaftung des Museums bei. Heute macht sich die vorausschauende Planung nicht nur in den reduzierten Kosten bemerkbar, sondern durch rundum zufriedene Museumsbesucher – denn der Gebäudebetrieb klappt reibungslos.
Aus Vision wird Realität
Inspiriert von allem, was die Marke Mercedes-Benz ausmacht – Eleganz, Hightech und Innovation –, machten sich die Projektmanager an die Arbeit und sorgten dafür, dass das Gebäude im vereinbarten Kostenrahmen mit höchster Qualität und im knappen terminlichen Rahmen umgesetzt wurde. Um das Gebäude in der extrem kurzen Bauzeit realisieren zu können, mussten alle Abläufe ineinandergreifen wie die Zahnräder eines SLK. Das Ausstellungskonzept von HG Merz war die Basis, von der aus das gesamte Gebäude geplant und umgesetzt wurde. Während der Bauzeit wurden vorgefertigte Stützen exakt am Tag des Einbaus auf die Baustelle geliefert. Für diese „Just in Time“-Bauweise mussten die Projektmanager das Ganze in Teilprojekte gliedern, saubere Schnittstellen schaffen, den Datenaustausch sichern – und das alles am Ende wieder zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügen.
Das Beste oder nichts
Das Beste oder nichts – Gottlieb Daimler formulierte diesen Satz in Bezug auf seine Produktphilosophie. Knapp 110 Jahre nach seinem Tod zeigt das Museum – innen und außen – eindrucksvoll, zu welchen Meisterleistungen sein Leitmotiv geführt hat.
Informationen
Drees & Sommer Stuttgart
Obere Waldplätze 13, D-70569 Stuttgart
Tel. (+49-711) 13 17-0
[email protected]
www.dreso.com
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Internationale Weihnachtskrippen: Publikums- magneten im Weihnachtsland Erzgebirge
Nachdem im letzten Winter mit Osteuropa und Südtirol zwei europäische Schwerpunkte die Ausstellung prägten, steht in der mittlerweile achten Weihnachtsausstellung ein Ausflug nach Afrika im Mittelpunkt. Mit Steinkrippen aus Simbabwe wird ein exotischer Kontrast zum Thema Holz geschaffen, für das die Ausstellung im Schlosspalais der sächsischen Kleinstadt weit über die Grenzen des Freistaats hinaus bekannt ist.
Die Kunst der Shona wird ab Mitte November traditionelle Krippen aus Holz kontrastieren und sowohl die biblische Weihnachtsgeschichte als auch sensible Einblicke vom Lebensgefühl Afrikas vermitteln. Die Shona-Bildhauerei ist eine wiederbelebte Künstlerbewegung, die in den 50er- bis 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts im damaligen Rhodesien entstand. Internationale Anerkennung erhielt die Shona-Kunst durch Ausstellungen in namhaften europäischen und amerikanischen Galerien. An den Adventssonntagen werden öffentliche Führungen durch die weihnachtliche Exposition angeboten.
Auch das Daetz-Centrum zeigt einige Shona-Arbeiten in seiner Dauerausstellung Meisterwerke in Holz mit ihren mehr als 550 Kunstwerken aus fünf Kontinenten. Getreu dem Motto des Hauses „… wo Holz lebendig wird“ werden mittels Audioguides Figuren aus Märchen, Legenden und den Mythologien der verschiedensten Völker der Erde zum Leben erweckt. Eine eindrucksvolle Reise um die Welt vermittelt der Rundgang durch die Holzbildhauerkunst des polynesischen Archipels, des geheimnisvollen Afrikas, der Traditionen nordamerikanischer Indianer und Inuit bis hin zu Meisterstücken Europas sowie der filigranen Faszination asiatischer Kunst und orientalischer Ornamentik.
Vielfalt garantiert auch das Jahr 2010. Auserlesen – Holzwurm trifft Leseratte widmet sich im Frühjahr der Beziehung von Holz und Literatur, während Die Kunst zum Leben das moderne erzgebirgische Kunsthandwerk in seiner Formenvielfalt präsentiert. Mit Berührungen – die fühlbar andere Ausstellung richtet sich im Sommer erstmals eine speziell konzipierte Schau an die Zielgruppe der Sehbehinderten.
Dass ein Besuch der Ausstellung für alle Gäste zum Erlebnis wird, liegt neben der inhaltlichen Vielschichtigkeit vor allem an der Servicequalität des Daetz-Centrums. Führungen durch die einmalige Holzbildhauerausstellung werden unter anderem in Gebärdensprache und in leichter Sprache angeboten. Ein geführter Rundgang für blinde und sehbehinderte Menschen ist genauso fester Bestandteil des Angebots wie Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer auf allen Etagen. 20 unterschiedliche thematische Führungen machen auch Wiederholungsbesuche immer wieder zu einem neuen Erlebnis.
Lichtenstein befindet sich auf halber Strecke zwischen Zwickau und Chemnitz. Erreichbar ist das Daetz-Centrum binnen weniger Minuten von den Autobahnen A4 (Abfahrt Hohenstein-Ernstthal) und A72 (Abfahrt Hartenstein).
Informationen
Sonderausstellung
Andere Länder, andere Krippen
13. November 2009 bis 31. Januar 2010
täglich 10–18 Uhr
Dauerausstellung Meisterwerke in Holz
ganzjährig 10–18 Uhr
Daetz-Centrum Lichtenstein GmbH
Schlossallee 2, D-09350 Lichtenstein
Tel. (+49-372 04) 58 58 58
[email protected]
www.daetz-centrum.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Museum der Phantasie
Lothar-Günther Buchheims Museum der Phantasie überrascht nicht nur durch seine hochkarätigen Werke deutscher Expressionisten und die außergewöhnliche Vielfalt seiner volks- und völkerkundlichen Sammlungen. Sonderausstellungen stellen neue Werkkomplexe der Buchheim’schen Kollektion und unbekannte Aspekte von Buchheims eigener künstlerischer Arbeit vor.
Doch nicht nur das, was im Inneren des Museums gezeigt wird, ist außergewöhnlich. Auch das offene, vielgliedrige und an ein gestrandetes Schiff erinnernde Museumsgebäude von Günter Behnisch mit rund 3500 Quadratmeter Ausstellungsfläche sowie die traumhafte Lage des Museumsgebäudes direkt am See sind einzigartig.
Auch im Herbst/Winter 2009/10 rotieren die Arbeiten auf Papier in den Bereichen, die für die Werke der Maler der Künstlergemeinschaft „Brücke“ (1905 bis 1913) Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Otto Mueller und Emil Nolde vorbehalten sind.
Im Mittelpunkt zweier Kabinettausstellungen stehen eindrucksvolle Werkgruppen von Christian Rohlfs und Otto Dix. Rohlfs’ lichte Landschaften entstanden Anfang der 1920er-Jahre vorwiegend in Oberbayern. In einer Reihe prachtvoller Aquarelle schildert Dix Charaktere und Typen der „goldenen Zwanzigerjahre“.
Die Fotografien von Lothar-Günther Buchheim (1918–2007) aus dem Jahr 1977 machen den Betrachter zum Augenzeugen eines singulären Ereignisses: Die Bonner Szene formiert sich zum prunkvollen Staatsempfang für das spanische Königspaar, Buchheim dringt mit seiner Kamera in Bereiche, die Presseleuten und Fotografen verschlossen bleiben. Als Tarnung und Arbeitskleidung dient ihm der vom Protokoll vorgeschriebene Frack. Sein Motiv: der Staat, der sich selbst darstellt. Der narrative Text, mit dem Buchheim seine Aufnahmen begleitet, trägt dieselbe unverwechselbare Handschrift wie seine Fotografien.
Die neue Bilddokumentation zum Thema traditionelle ozeanische Baststoffe sucht den Symbolgehalt des heutzutage selten gewordenen Rindenbaststoffs zu erläutern.
Wir danken der Unternehmensgruppe WWS Kurt Strube, die unser Museum seit Jahren zu unserer vollsten Zufriedenheit betreut, für die freundliche Förderung dieses Beitrags und freuen uns über die gute Zusammenarbeit.
Ausstellungen
• Staatsgala – Fotografien von Lothar-Günther Buchheim
• Christian Rohlfs – Wahrnehmung und inneres Bild
• Otto Dix – Die goldenen Zwanzigerjahre
• Tapa unter der Lupe – Symbolträchtiger Baststoff aus Ozeanien
alle Ausstellungen bis 10. Januar 2010
Informationen
Bonusangebote für die
Herbst-Winter-Saison 2009/10
(1. November 2009 bis 31. März 2010)
Museumsdreieck Expressionismus Card
Besucher mit einer Eintrittskarte des „Schloßmuseums“ in Murnau oder des
Franz-Marc-Museums in Kochel vom
1. November 2009 bis 31. März 2010 erhalten ermäßigten Eintritt:
pro Person 7 Euro
60 Plus Card
Ermäßigter Eintritt für Besucher, die
das 60. Lebensjahr erreicht haben
(gegen Vorlage eines Ausweises):
pro Person 7 Euro
Coffeetime Card
Eintrittskarte mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen nach Wahl im Restaurant-Café Phoenix:
pro Person 12 Euro
Last Minute Card
Ermäßigter Eintritt ab 16 Uhr:
pro Person 5 Euro
Family Card
Reduzierter Eintritt für zwei Erwachsene
und alle Kinder bis zu 18 Jahren:
15 Euro
Buchheim Museum
Am Hirschgarten 1, D-82347 Bernried
Tel. (+49-81 58) 99 70-0
Di–So und Fei
April bis Oktober: 10–18 Uhr
November bis März: 10–17 Uhr
[email protected]
www.buchheimmuseum.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Mensch – Maschine – Mode – Muster
In den historischen Hallen der Augsburger Kammgarnspinnerei (gegründet 1836) zeigt das tim als Landesmuseum in lebendiger Form die wechselvolle Geschichte der Textilindustrie in Bayern. Augsburg ist dafür als Schauplatz hervorragend geeignet: Die Stadt kann mit einer großen Tradition als Textilmetropole von europäischem Rang aufwarten.
Im tim präsentieren sich die vier M: Mensch, Maschine, Mode, Muster. Es geht um Menschen, um Arbeiter, deren Leben seit dem 19. Jahrhundert vom Takt der Maschinen bestimmt wurde, aber auch um all die Unternehmerpersönlichkeiten, Politiker und Bankiers, welche die Geschicke der Textilbranche lenkten.
Für die Maschinen ist im tim eine eigene Museumsfabrik eingerichtet. In den beeindruckenden Shedhallen rattern historische Webstühle neben modernen Hightechmaschinen. Besucher erleben hautnah, wenn tim-Produkte, wie zum Beispiel das Schlossertuch oder das Fugger-Barchent, entstehen.
Für die Mode ist in der Dauerausstellung ein eigener Laufsteg reserviert. Vom Biedermeier- bis zum Flower-Power-Kleid – das tim erzählt nicht nur 200 Jahre Mode- und Kostümgeschichte, sondern auch, was deren Trägerinnen darin erlebt haben.
Hinter dem Stichwort Muster verbirgt sich im tim nationales Kulturgut: die weltweit einzigartige Stoffmustersammlung der Neuen Augsburger Kattunfabrik (NAK). Das sind mehr als 200 faszinierende Jahre Mode und Design made in Augsburg. Das renommierte Stuttgarter Atelier Brückner (BMW-Museum München, Dornier-Museum Friedrichshafen) setzt die Stoffmuster auf über vier Meter großen Grazien einzigartig in Szene. Stararchitekt Klaus Kada aus Graz hat dafür eigens eine neue Shedhalle entworfen.
Das Obergeschoss im tim steht für Veranstaltungen wie Modenschauen, Messen, Firmenevents oder Sonderausstellungen zur Verfügung.
Vom 21. Mai bis 10. Oktober 2010 ist dort die Bayerische Landesausstellung zu Gast. Das Thema: Bayern–Italien: Sehnsucht, Strand und Dolce Vita (Infos auf www.bayern-italien.hdbg.de).
Auch wenn Kleidung heute weitgehend in Fernost produziert wird – dort, wo Ingenieurwissen und Kreativität gefragt sind, prägt der Standort Bayern den textilen Weltmarkt nach wie vor entscheidend mit. Das Museum zeigt brandaktuelle Trends, wie etwa intelligente Kleidung oder das spannende Thema Karbon. All das ist zu sehen im tim, im Textil- und Industriemuseum Augsburg. Dort, wo ab Anfang 2010 Geschichte auf Zukunft trifft.
Das Bayerische Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) wird ab Jänner 2010 auf die bewährten Dienstleistungen der renommierten Unternehmensgruppe WWS Strube GmbH vertrauen.
Informationen
tim – Bayerisches Textil- und
Industriemuseum Augsburg
Provinostraße 46, D-86153 Augsburg
Tel. (+49-821) 81 00 15-0 oder
(+49-821) 324 46 88
Di–So 9–18 Uhr
[email protected]
www.tim-bayern.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Die Vandalen stürmen das Karlsruher Schloss
Die Ausstellung zeichnet ein neues Bild jener antiken Großmacht, die im Bewusstsein der Öffentlichkeit stets mit negativen Assoziationen verbunden ist. Ein Großteil der spektakulären Exponate aus nordafrikanischen Museen wird zum ersten Mal in Europa zu sehen sein.
Zu Beginn des 5. Jahrhunderts befand sich das krisengeschüttelte römische Weltreich im Umbruch. Zahlreiche germanische und reiternomadische Stämme wanderten auf der Suche nach einer neuen Heimat quer durch Europa. Zu diesen Völkerverbänden zählten auch die Vandalen, die den Rhein überschritten, in Gallien einfielen, weiter durch Spanien zogen und 429 ein unerhörtes Unterfangen realisierten: Mit 80000 Menschen wagten sie die Überfahrt nach Nordafrika, eroberten das fremde Territorium und gründeten schließlich ein mächtiges Königreich, das für kurze Zeit die Geschicke des Mittelmeerraums bestimmte.
Damit waren die Vandalen die ersten der völkerwanderungszeitlichen „Barbaren“, die für sich in Anspruch nahmen, die Erben der alten Großmacht zu sein. In den Augen Roms besaß ihr Staat keine Legitimation. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass die Vandalen ein wohlgeordnetes Staatswesen pflegten. So wird die Sonderausstellung dieses Bild der Vandalen relativieren, die zwar sprichwörtlich als zivilisationsfeindliche Zerstörer gelten, doch tatsächlich als Bewahrer römischer Kultur und Lebensart anzusehen sind.
Rund 500 hochkarätige Objekte aus nordafrikanischen und europäischen Museen geben Zeugnis von der Kunst und Kultur zur Zeit der Vandalen: Prachtvolle Mosaike, darunter die Dame von Karthago und der Vandalische Reiter, die kunstvolle Skulptur des göttlichen Mundschenks Ganymed und kostbarer Schmuck aus dem Grabfund von Koudiat Zâteur führen Reichtum und Kultiviertheit der romanisierten Oberschicht vor Augen. In der Inszenierung einer spätantiken Villa sind die Objekte in ihren ursprünglichen Kontext eingebettet.
Weitere Höhepunkte stellen die beiden einzigen existierenden Bauinschriften aus dem vandalischen Königshaus – die des Königs Thrasamund aus der Basilika von Henchir el-Gousset und die des Prinzen Gebamund, die den Bau von Thermen mit einem Gedicht rühmt – dar.
Dass die Vandalen Christen waren, belegen zahlreiche biblische Darstellungen auf Öllampen, Sarkophagen und Mosaiken. Die Entwicklung und Kontinuität des frühchristlichen Kirchenbaus in spätrömischer, vandalischer und byzantinischer Zeit veranschaulichen Modelle der Basilika Damous el-Karita in Karthago oder der Kirche im westtunesischen Henchir el-Gousset.
Der begehbare Einbau eines mosaizierten Taufbeckens verrät, wie die Menschen sich damals zum Christentum bekannten. Erstmalig wird auch der Sarkophag von Lamta ausgestellt – er gilt als ein Zeugnis der Ausbreitung des frühen Christentums.
Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog mit Beiträgen renommierter Vandalenforscher. Ein vielfältiges Begleitprogramm mit Fachvorträgen, Führungen und exklusiven Abendevents rundet das Angebot ab.
Informationen
bis 21. Februar 2010
Badisches Landesmuseum Karlsruhe
Schloss, D-76131 Karlsruhe
Di–So und Fei 10–18 Uhr, Do 10–21 Uhr
Info-Hotline: Tel. (+49-721) 926 28 28
[email protected]
www.vandalen2009.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.
Adolf Senff. Blütenreigen und Farbenpracht
Die Wertschätzung des in Halle geborenen Künstlers ist eng mit der Geschichte der Sammlung verbunden. Bereits 1885, im Gründungsjahr des Halleschen Kunstmuseums, wurde eine Senff-Ausstellung organisiert, in deren Folge weitere Ankäufe erfolgten.
Das Museum präsentiert in der Ausstellung mit etwa 30 Blumenbildern ein Fest der Schönheit, denn in diesen Werken Senffs ist die Pracht einer unendlich fein nuancierten Farbenwelt zu bewundern.
Adolf Senff hatte sich nach einem abgeschlossenen Theologiestudium, das er 1808 in Halle absolvierte, der Kunst zugewandt. Von Förderern bestärkt, wurde der junge Zeichner 1809 für die Söhne des Malers Gerhard von Kügelgen in Dresden als Hauslehrer bestellt und fand so erste Kontakte zu den Vertretern der Romantik. 1816 zog Senff nach Rom, wo er bis 1848 im Umkreis der Nazarener sein Werk entwickelte. Der Maler wurde vor allem für seine Porträts, aber auch für seine Kopien nach Raffael geschätzt. Ab 1825 entstanden neben den religiösen Darstellungen Hunderte von Blumenbildern, die ihm den Ehrennamen „Raffaelo dei fiori“ (Blumenraffael oder Raffael der Blumen) einbrachten.
Veranstaltungsvorschau: Adolf Senff. Blütenreigen und Farbenpracht - Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
Keine aktuellen Termine vorhanden!Musik – automatisch schön!
Das Deutsche Musikautomaten-Museum (DMM) in Bruchsal wird ein Vierteljahrhundert alt. Aus diesem Anlass zeigt das im Schloss untergebrachte Museum die Sonderausstellung Musik – automatisch schön! und präsentiert 14 der schönsten Stücke aus seiner Sammlung. Dafür wurden – quasi unter den Laborbedingungen einer kleinen Ausstellung mit reduziertem Budget – neue Darbietungsformen ausprobiert, die einer angestrebten Neukonzeption der Dauerausstellungsfläche zugrunde liegen. Die Ausstellung, die bis einschließlich 31. Januar 2010 in Bruchsal zu sehen ist, wird von einer Audio-CD begleitet, auf der Tonbeispiele der ausgestellten Exponate zu hören sind. Außerdem enthält die CD ein Booklet, das – anstelle eines reinen Textkatalogs – alle Ausstellungstexte vereinigt.
Die Geschichte des Deutschen Musikautomaten-Museums beginnt am 30. Mai 1984, jenem Tag, an dem in Anwesenheit von Wissenschaftsminister Helmut Engler im Bruchsaler Schloss das Museum Mechanischer Musikinstrumente eröffnet wurde. Die damalige Dauerausstellung und Sammlung bestand aus den vom Baden-Badener Privatsammler Jan Brauers erworbenen historischen Musikautomaten. Dieser hatte seit 1975 in der Kurstadt an der Oos ein Privatmuseum betrieben, seine Sammlung jedoch wegen Standortunsicherheiten zum Verkauf angeboten. Das Badische Landesmuseum fand sich als Käufer und wurde bei der Übernahme dieser Schätze in großzügiger Weise sowohl von der Landesregierung als auch den am Zentralfonds beteiligten Museen unterstützt.
Zwischen 1982 und 1990 erwarb das Badische Landesmuseum 142 Objekte von Jan Brauers – bisweilen als spektakuläre Einzelankäufe. 1988 etwa kaufte das Museum für damals eine Million Mark in den USA die große Karussellorgel „Selection“ der Waldkircher Firma Bruder ein und brachte sie nach Bruchsal. Rund um die Sammlung von Jan Brauers wurde das Bruchsaler Museum systematisch durch Zukäufe aus Privatbesitz und dem Kunsthandel vergrößert. 1995 etwa konnte die sogenannte „Elefantenuhr“, eine hoch artifizielle Spieluhr, die zum ursprünglichen Inventar des Schlosses Bruchsal gehörte, auf der spektakulären Sotheby’s-Auktion der Sammlung der Markgrafen und Großherzöge von Baden dank der großzügigen Unterstützung der Firma SWE-Eurodrive (Bruchsal) wieder für ihren alten Standort zurückgewonnen werden.
Die meisten Erwerbungen wurden über die Zentralfondsmittel des Landes Baden-Württemberg finanziert. 2003 kam es zu einer neuerlichen spektakulären Erweiterung der Sammlung: Die Kunststiftung der Länder machte den Kauf von 106 Objekten aus der bedeutenden Privatsammlung Jens Carlson in Königslutter für etwa sechs Millionen Mark möglich. Das Gesicht des Museums hatte sich damit verändert – es barg nun eine der größten öffentlichen Sammlungen von Musikautomaten weltweit. Vor diesem Hintergrund wurde die Dauerausstellung des Museums im Jahr 2003 in erweiterten Räumen neu eingerichtet und das Haus am 6. Dezember 2003 in Deutsches Musikautomaten-Museum umbenannt.
Unter der Leitung von Dr. Wolfram Metzger und dank der Mitarbeit eines engagierten Teams von Restauratoren und Aufsehern wuchs das Deutsche Musikautomaten-Museum in den vergangenen 24 Jahren zu einem rund 500 Exponate beherbergenden Fachmuseum mit großer Reputation. Heute besitzt das DMM eine der weltweit größten öffentlichen Sammlungen im Bereich der Musikautomaten. Seit April 2008 wird es von einem neuen Team unter der Leitung von Brigitte Heck, M. A., als Außenstelle des Badischen Landesmuseums Karlsruhe betreut.
Die WWS Strube GmbH sorgt mit seinen kompetenten und motivierten Mitarbeitern für einen reibungslosen Museumsbetrieb auf Schloss Bruchsal.
Informationen
Musik – automatisch schön!
25 Jahre Deutsches Musikautomaten-Museum
bis 31. Januar 2010
Di–So und Fei 10–17 Uhr
Zur Ausstellung erscheint die ausstellungsbegleitende Audio-CD Musik – automatisch schön! Die CD mit Booklet kostet 9,90 Euro und ist sowohl in den Museumsshops der Schlösser Bruchsal und Karlsruhe als auch im virtuellen Museumsshop des Badischen Landesmuseums Karlsruhe erhältlich.
Deutsches Musikautomaten-Museum
Außenstelle des Badischen Landesmuseums
Schloss, D-76646 Bruchsal
Tel. (+49-72 51) 74 26 52
www.landesmuseum.de
Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.






























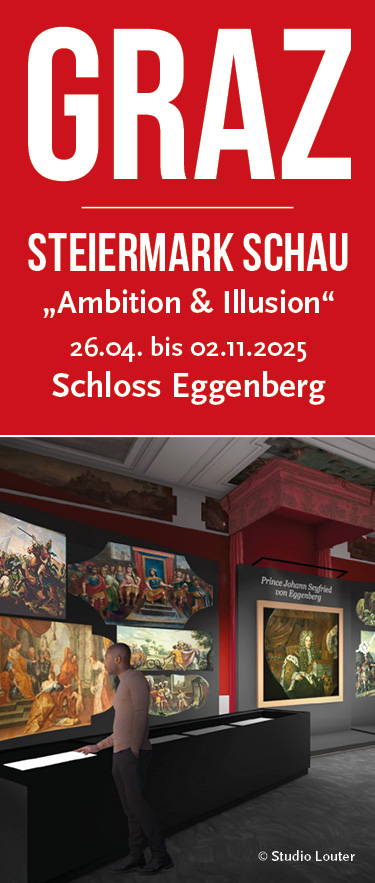







Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.