Das Spiel der Mächtigen
Ein Motto, das allerlei Assoziationen weckt, beispielsweise an das neoliberal beschworene „freie Spiel der Kräfte“ (des Markts). Der Mensch als Spielball unberechenbarer Mächte: Dieses antike Bild für die existenzielle Unsicherheit ist angesichts der Wirtschaftskrise unserem Empfinden auf einmal wieder nahegerückt. Dazu befragt Salzburg eine Reihe beachtenswerter, teils selten aufgeführter Werke.
Was für Mächte sind es überhaupt, die da mit uns spielen? Zu verschiedenen Zeiten haben sich Menschen die über ihnen waltenden Schicksalsmächte unterschiedlich vorgestellt: die „ananke“ der griechischen Antike, eine Macht zwischen Notwendigkeit und Verhängnis; oder der unerbittliche Ruf nach Gehorsam des alttestamentarischen Gottes; die Gefolgschaft Jesu in der Frühzeit des Christentums mit heilsgewiss selbstloser Opferbereitschaft, die im milden Licht der Legende tröstliche Zuversicht verströmt – alles Schicksalskonzepte oder Weltdeutungen, die uns Heutigen auf den ersten Blick fremd erscheinen. Von ganz unmittelbarer Aktualität dagegen der Alleinvertretungsanspruch, den konkurrierende Religionen auf Moral, Heil und ewige Wahrheit erheben und der zuletzt doch materiellen und politischen Machterhalt oder -gewinn zum Ziel hat. Zuletzt gibt es da noch eine Macht, die kaum je mit den Mächtigen im Bunde steht: die anarchische, systemsprengende Macht der Liebe, die zwar selten siegt, doch immer Antrieb für Auflehnung und Aufstand ist, ein zündender Funke für Veränderung und Umsturz, aber auch die Flamme der Selbstzerstörung.
Seit Menschengedenken werden Machtspiele – Statuskonflikte, Verteilungskämpfe, Ringen um Vorrechte und Privilegien – auf Kosten derer ausgetragen, die beherrscht werden: versklavt oder unterworfen, besetzt, belagert oder manchmal auch nur regiert. Dabei geht es stets auch um die Herrschaft über Köpfe, über Geist und Glauben. Und allzu oft erliegen die Mächtigen dem Sog der Macht, missbrauchen sie, überschreiten Grenzen und üben Herrschaft auf dem Rücken der Beherrschten aus.
Vielleicht im Widerspruch zur historischen Wahrheit erzählt das Theater die Geschichte von Auflehnung als Geschichten Einzelner, die sich, von Liebe getrieben, unmenschlichen Geboten widersetzen – um den Preis der eigenen Unversehrtheit, um den Preis des Lebens. Das Scheitern nimmt dem Versuch nichts von seiner Würde und Schönheit – das „trotzdem“ war und ist ein Leitmotiv des Widerstands.
Das Märtyrertum treibt das Spannungsverhältnis von Idealismus und Humanismus auf die Spitze, ein labiles Konstrukt höheren Sinns: Nur wenige Gedankenschritte führen vom demütigen Selbstopfer zur demonstrativen Selbstgerechtigkeit zum Fanal des Fanatismus. Wenn die Revolution ihre Kinder frisst, der Umsturz die Verhältnisse verkehrt und neu Ermächtigte das Spielfeld dominieren, gelten von Neuem die alten Regeln der Macht.
Der Mensch in der Revolte
Dazu gehören auch Fragen wie „Ist Recht auf Widerstand ein Menschenrecht?“, „Welche Unterdrückung rechtfertigt welche Mittel der Auflehnung?“, „Rechtfertigt die Befreiung einer Stadt, eines Landes Hinterhalt und Tyrannenmord?“ und „Gibt es Verantwortung ohne Schuld?“.
Im Programmbuch der Salzburger Festspiele stellt Wolf Lepenies den Essay „L’homme révolté“ von Albert Camus vor, der als Beitrag zu dem Diskurs über Macht und Widerstand unbedingt beachtenswert und – 1951 geschrieben – von ungebrochener Aktualität ist; wie er das Verhältnis von Macht (Politik) und Kunst beleuchtet, mag programmatisch zur diesjährigen Dramaturgie angestiftet haben. Der Text ist als rororo-Taschenbuch erhältlich.
Den Bühnenwerken, anhand deren die Salzburger Festspiele dem Spiel der Mächtigen nachspüren, liegen historische Begebenheiten oder für das Geschichtsverständnis konstitutive mythische Stoffe zugrunde: Von alttestamentarischer Überlieferung über die griechische Antike, die Anfänge des Christentums und die Kreuzzüge des Mittelalters bis zu revolutionären Aufbrüchen des 19. und 20. Jahrhunderts reichen die Vorlagen; von der Entstehungszeit der Werke trennt sie jeweils eine ordentliche Zeitspanne. Diese Distanz ermöglicht erst jene Reflexion des Gegenwärtigen im Vergangenen, die all diese – von Epoche zu Epoche mit unterschiedlicher Intention – Vergegenwärtigungen beflügelt. Als dritte Zeitebene wird unsere Gegenwart in diesem multiplen Prozess der Widerspiegelungen wirksam – durch die theatralische Umsetzung wie durch unsere Augen und Ohren: Was uns aufhorchen lässt und was nicht, was wir befremdlich finden oder bemerkenswert, welche Assoziationen sich uns eröffnen und welche Querverbindungen wir herstellen – Rezeption ist immer ein produktiver Teil des Kunstgeschehens, doch besonders sinnfällig in einem solchen Projekt.
Ein Gott, der verlockt und rächt
Der älteste Text, Die Bakchen des Euripides aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, exponiert alle Facetten des Themas: In die scheinbar gefestigte, wohl gesetzte Ordnung des siebentorigen Theben bricht – eine Provokation! – der junge Gott Dionysos ein; viele folgen ihm und seinem Ruf, allen voran die Frauen, doch Pentheus, der Herrscher Thebens, verweigert ihm die Ehre und verfolgt seine Anhänger. Doch er selbst erliegt der Lockung des verhängnisvollen Fremden, von ihm selbst angestachelt übertritt er die Gesetze des Kults und wird von den Mänaden, darunter seine eigene Mutter, zerrissen: Schuldiger und Opfer eines rachsüchtigen Gottes, besiegelt sein Schicksal den Untergang eines Herrscherhauses, das nicht mit anderen Mächten gerechnet hat, einer Menschenordnung, die das Un- oder Übermenschliche aus ihrer Mitte fernzuhalten versuchte …
Der Tod verwehrte Jürgen Gosch diese Inszenierung und uns die Einsichten und Abgründe, die er Euripides abgewonnen hätte; seine Lesart des Texts bringen die Schauspieler der Produktion zu Gehör, und eine Filmaufführung von Goschs Inszenierung des Ödipus von Sophokles wird einen Eindruck davon vermitteln, mit welcher Radikalität der Regisseur nach dem Kern des Theaters (und der menschlichen Existenz) schürfte.
Von Gott geleitet, der die Ungehorsamen bestraft
Wird ein Gott den Thebanern zum Verhängnis, so ist Gott der Befreier des biblischen Volks aus ägyptischer Sklaverei. Auch dieser Gott kann grausam sein, das bekommen die Ägypter zu spüren, die das auserwählte Volk verfolgen, bis das Rote Meer sie verschlingt. Jürgen Flimm inszeniert Gioacchino Rossinis vieraktige Grand opéra Moïse et Pharaon ou Le passage de la Mer Rouge, die 1827 in Paris uraufgeführt wurde. Sie gilt als zukunftsweisendes Werk des zu Unrecht gern auf seine Opere buffe reduzierten Rossini (Dirigent: Riccardo Muti). Die musikalische Hauptrolle hat der Chor; mit einem farbig und facettenreich ausgestalteten Orchesterpart, dem neuartigen Einsatz musikalischer Motive zur Herstellung inhaltlicher Bezüge, mit über weite Strecken durchkomponierten Formen und packend gestalteten Aktfinali nimmt Rossini Gestaltungslösungen vorweg, die im Lauf des 19. Jahrhunderts weiterentwickelt wurden. Wie es in der Oper die Regel ist, wird der Konflikt zwischen den Ägyptern und den Israeliten durch deren Repräsentanten ausgetragen, Moses und den Pharao. Der Einzelne und die Gemeinschaft ist stets ein konfliktträchtiges Thema, nicht nur im Verhältnis von Herrscher und Volk oder Herrscher und aufbegehrenden Sklaven. Es gibt Partikularinteressen und widerstreitende Triebkräfte, etwa die Liebe zwischen dem Pharaonensohn Aménophis und Anaï, der Nichte des Moses. Ihr Schwanken zwischen dieser Neigung und der Verbundenheit mit ihrem Volk, die von Enttäuschung genährte Anmaßung des Herrschersohns schärfen den immanenten Konflikt. Ein unterdrücktes Volk unter fremder Herrschaft, der Appell an die religiöse Toleranz der herrschenden Mächte, die Sehnsucht nach Befreiung – dazu hat jede Zeit ihre Anschauungsbeispiele. Das Gebet der Israeliten vor dem Durchzug durch das Rote Meer wurde in Italien ähnlich dem Gefangenenchor aus Nabucco zu einem patriotischen Leitmotiv.
Im Zwiespalt von Liebeszauber und Christenpflicht
In der Oper des 19. Jahrhunderts vollzieht sich Geschichte in der Regel im Konflikt zwischen Volk und Einzelnem, zwischen dessen politischer Mission und persönlicher Existenz: Im Widerstreit von Staatsräson (oder Machtbegehr) und Liebe zerbricht meist der Mensch. Geradezu vorweggenommen erscheint dies in Haydns letzter Opera seria, Armida, mit 54 Vorstellungen in fünf Jahren im Theater zu Eszterháza selbst und Aufführungen bis Prag und Dresden die zu seinen Lebzeiten erfolgreichste von Haydns Opern. Der Stoff ist eine viel vertonte Episode aus Torquato Tassos Gerusalemme liberata, die sich im Barock – etwa in Händels Rinaldo – großer Beliebtheit erfreute, dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine verblüffende neue Blüte erlebte. Haydns Libretto, man muss es sagen, ist kein Meisterwerk: lose Fäden allenthalben. Doch bezwingt die Oper durch ihre Konzentration auf die Hauptfiguren und den Kernkonflikt: die heidnische Zauberin, die den christlichen Ritter eigentlich nur unschädlich machen sollte, sich jedoch in ihn verliebt – und der Kreuzfahrer, der Armida verfällt und gegen die eigenen Gefährten in den Kampf ziehen will … Für ihre Not und Zweifel schrieb Haydn Musik, die – auf die begrenzten Möglichkeiten von Eszterháza abgestimmt und wenig theatralisch – durch ihre seelische Intensität bezwingt und nicht zuletzt durch den außerordentlich farbenreichen Orchesterpart bezaubert, der Armidas Zauberwald als paradiesischen Zufluchtsort erklingen lässt. Der Zauberwald wird abgeholzt, der Ritter genügt seiner Pflicht, die verlassene Zauberin bleibt zurück – die „scena ultima“ versagt die glückliche Lösung, der Konflikt bleibt ungelöst, die Liebe zerbricht am Clash of Civilizations: ein geradezu modern anmutendes Ende (Regie: Christof Loy, Dirigent: Ivor Bolton, Mozarteumorchester Salzburg).
Femme fatale in biblischem Auftrag
Weibliche Waffen im Kampf der Kulturen – Beispiele dafür liefert die Bibel mehrfach. Ähnlich beliebt wie der Armida-Stoff ist die Geschichte von Judith und Holofernes, die einem Apokryphen des Alten Testaments entstammt und unzählige künstlerische Gestaltungen inspiriert hat. Darunter das Oratorium Juditha triumphans von Antonio Vivaldi, komponiert 1716 für eine Festaufführung anlässlich des mit Unterstützung Habsburgs eben errungenen militärischen Siegs Venedigs über die Türken: Hier bildet der Jubel über die Befreiung der Stadt Bethulia von der Belagerung durch die Assyrer die Folie für den Triumph der (historisch schon im Niedergang befindlichen) Seemacht Venedig. Später bekommt die Geschichte von der schönen Witwe, die heimlich ins Lager der Feinde schlüpft, den assyrischen Feldherrn Holofernes betört und ihm dann den Kopf abschlägt, noch andere Nuancen: Nicht nur er, auch sie verliebt sich in den Feind; Friedrich Hebbel lotete wohl als Erster das selbstdestruktive Potenzial dieser Lesart aus. Eine Kombination gerade dieser beiden Extremdeutungen setzt der Regisseur Sebastian Nübling als Schauspiel mit Musik mit seinem Komponistenpartner Lars Wittershagen, dem Stuttgarter Ensemble sowie der capella triumphans (Leitung: Annelie Gahl) in Szene.
Im Vertrauen auf das ewige Leben
Der Zwiespalt zwischen der Verpflichtung und Verbundenheit mit Volk oder Religion und der unmöglichen Liebe zu einem Feind bringt Frauengestalten wie Judith, Armida oder Anaï ins Wanken. Doch auch ohne Zweifel oder Anfechtung dieser Art ist das Schicksal einer Abtrünnigen von der Staatsreligion, der Vertreterin einer religiösen Minderheit schwer und bitter. Theodora in Antiochia weigert sich, dem römischen Gott Jupiter zu huldigen, denn sie ist Christin. Sie wird ins Gefängnis geworfen, doch der zum christlichen Glauben konvertierte römische Offizier Didymus befreit sie, indem er ihren Platz einnimmt. Als sie erfährt, dass er zum Tod verurteilt ist, appelliert sie um Gnade – und geht, als diese verweigert wird, mit ihm in den Tod. Einer Novelle von Robert Boyle von 1687 folgend, verarbeitete Thomas Morell, Händels Librettist auch bei Judas Maccabäus, diese Geschichte für ein Oratorium, das Händel in kaum mehr als einem Monat komponierte und das er selbst für sein bestes hielt. Es wurde 1750 in London uraufgeführt. Unruhe und mit Pauken und Trompeten auftrumpfende Musik charakterisieren die Römer und ihren Anführer, die noch nicht zum Heil gefunden haben. Die christlichen Märtyrer aber kennzeichnen weniger dramatische Eruptionen und innere Kämpfe als getragene Tempi und leise Töne; die erste Kerkerarie der Theodora ist eine tief berührende Auseinandersetzung mit dem Tod, und auch die Chöre erscheinen leise, in sich gekehrt. Eine „schwebende Melancholie“ (Silke Leopold) prägt das eindrucksvolle Oratorium, das im Jahr 2000 unter William Christie bei den Pfingstfestspielen in Salzburg zu hören war. Christof Loy unternimmt nun das Wagnis, das Oratorium szenisch auf die Bühne zu bringen (Dirigent: Ivor Bolton, Freiburger Barockorchester, Salzburger Bachchor) – während die Befreiungsoper schlechthin, Beethovens Fidelio, vom West-Eastern Divan Orchestra unter Daniel Barenboim konzertant aufgeführt wird.
Unter der großen Sonne, von Liebe beladen
Die modernste und vielleicht komplexeste Auseinandersetzung mit Macht, mit Repression und Auflehnung ist Luigi Nonos Musiktheaterwerk Al gran sole carico d’amore. Als „azione scenica in due tempi“ – szenische Handlung in zwei Zeiten – bezeichnete der Komponist, für den Kunst und politische Stellungnahme untrennbar miteinander verbunden waren, seine theatralische Reflexion revolutionärer Situationen: Er erzählt keine durchgehende Handlung, sondern montiert Situationen und Bilder aus verschiedenen historischen Kontexten zu einem Kaleidoskop, durch das Grundthemen – etwa Befreiungskämpfe und ihre geschichtliche Bedeutung, der Beitrag der Frauen dazu, die Rolle des Einzelnen im revolutionären Geschehen – in vielerlei Facetten Gestalt annehmen. Die Pariser Kommune von 1871 mit der Protagonistin Louise Michel, die russische Revolution 1905 und Maxim Gorkis Gestalt der Mutter, der Guerillakampf in Bolivien und die Aktivistin Tania Bunke sowie die Turiner Arbeiterunruhen der 50er-Jahre mit der ursprünglich von Cesare Pavese inspirierten Gestalt der Deola bilden die einander überlagernden historischen Folien mit ihren jeweiligen Protagonistinnen. Das Werk entstand Anfang der 70er-Jahre in Zusammenarbeit mit dem Regisseur und damaligen Leiter des Moskauer Taganka-Theaters, Juri Ljubimow, dem Bühnenbildner Dawid Borowski und Claudio Abbado; eine Fülle von Texten – Sachtexte, Bekenntnisse, literarische Texte aus allen möglichen Quellen – floss in das Werk ein, das 1975 in Mailand uraufgeführt wurde. Eine zweite, stärker szenisch orientierte Fassung brachte Jürgen Flimm 1978 an der Frankfurter Oper heraus. Für die neue Inszenierung verpflichtete er die britische Regisseurin Katie Mitchell, die damit ihr Salzburg-Debüt gibt, die musikalische Leitung übernimmt Ingo Metzmacher.
Wer möchte, kann diese Dramaturgie durchaus als Manifest verstehen: Jürgen Flimm bekennt sich programmatisch zur politischen Dimension von (Musik-)Theater. Man wird sehen, ob und wie sein Nachfolger Alexander Pereira – von kritischen Stimmen vorderhand unter den Vorverdacht eines rein kulinarischen, spitzensänger-zentrierten Opernbetriebs gestellt – diesen Anspruch aufrechterhält. Einstweilen gilt es, sich einzulassen – gerade auf die ungewöhnlichen und vielversprechenden Programmpunkte dieser ambitionierten Dramaturgie.
















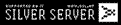



Leserkommentare
Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.